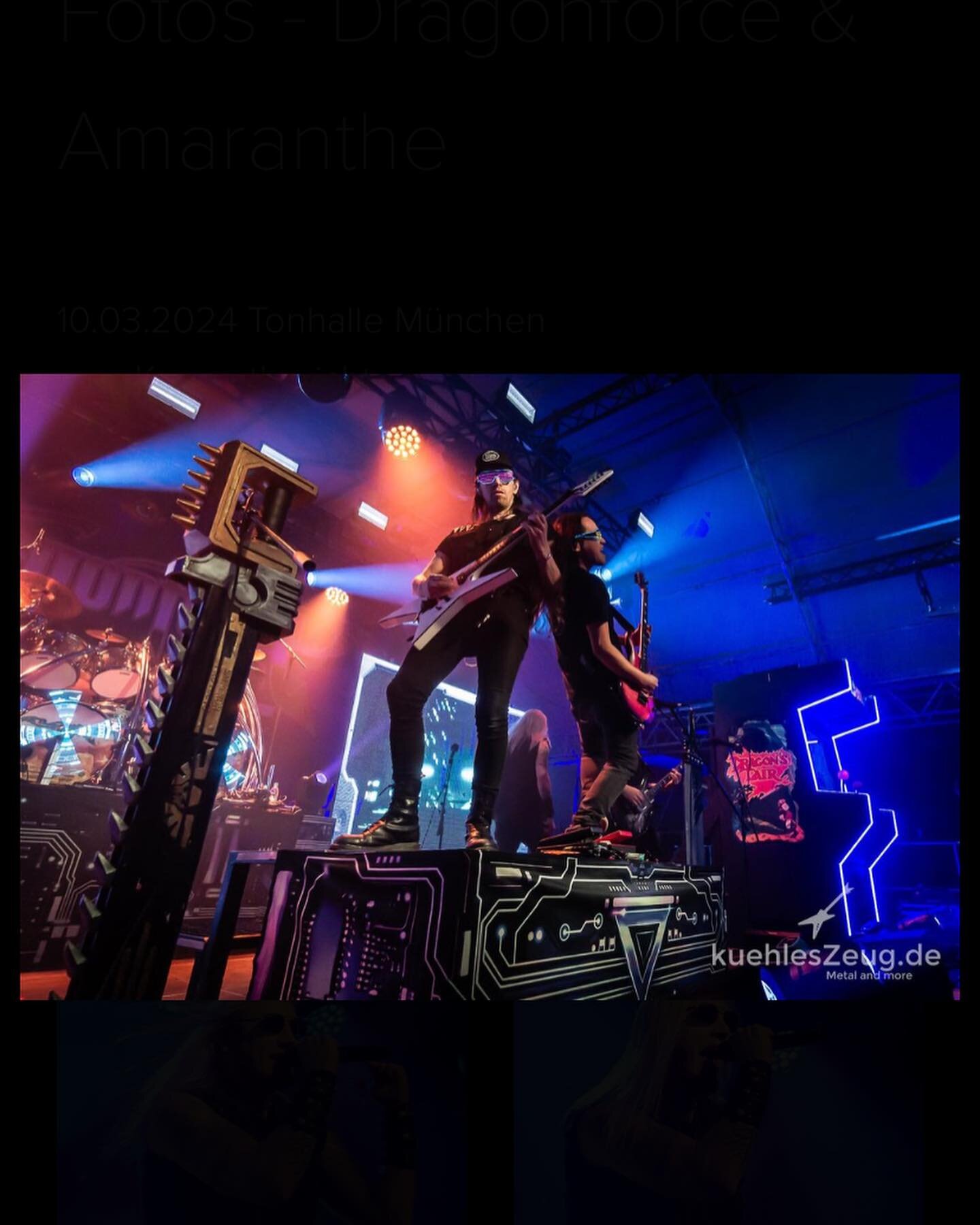Eine Insel mit Destillen oder die große Überfahrt: wir tasten bei horizontalem Regen am Ende der Welt! Folge 1
/Reif für die Insel – das ist jeder ernsthafte Liebhaber des Lebenswassers irgendwann einmal. Man mag im heimischen Wohnzimmer noch so viel über Rauch, ppms und Seetang philosophieren: nur vor Ort wird das Konzept Islay-Malt wirklich mit Leben erfüllt. Und da gehören launiges schottisches Wetter, single track roads und unwägbare Transportoptionen ebenso dazu wie legendäre warehouses und knorrige Originale. Begleiten Sie die Besatzung des Kreuzers Islay auf ihrer Mission am Rande des Universums!
Folge 1: Von Aschebersch nach Campbeltown
Eine Seefahrt, die ist lustig, und will vor allem gut geplant sein. Der Weg zur weltbekannten Whisky-Insel Islay führt nun einmal unweigerlich per Fähre übers Meer, wenn man nicht einen der wenigen Flüge erwischt, die von Glasgow oder Oban angeboten werden und jeweils für einige wenige abenteuerlustige Gesellen Platz bieten. Um eine möglichst konzertierte Anreiseaktion zu gewährleisten, entscheiden wir uns für den gemeinsamen Flug von Frankfurt nach Glasgow, um von dort per Mietwagen weiter Richtung Campbeltown zu düsen, wo mit Springbank und Glen Scotia gleich zwei kleine Schätze auf dem Weg liegen, die von vielen Islay-Reisenden vollkommen zu Unrecht links liegen gelassen werden. Gleich zu Beginn scheinen wir allerdings den Zorn der Glücksgötter heraufbeschworen zu haben: ein Mitstreiter fällt einem Komplettzusammenbruch des gewählten ICEs zum Opfer und muss am Folgetag nachkommen. Die Restgruppe sieht sich am Flughafen mit der freudigen Aussage konfrontiert, der reservierte und bezahlte Parkplatz sei leider heute schon voll. Nach einer kleinen Odyssee zum Ausweichparkhaus meistern wir auch diese Unbill und vertreiben uns die Zeit während des überraschenderweise weder gestrichenen noch verspäteten Flugs mit einem zünftig-querdenkerischen Kreuzworträtsel. Vor Ort in Glasgow wartet die nächste böse Überraschung (Achtung, es folgt eine Reisewarnung): der Anbieter unseres Mietwagens www.greenmotion.co.uk entpuppt sich als Halsabschneider-Laden, der nicht nur uns, sondern nahezu allen armen Opfern unter fadenscheinigen Begründungen drastisch mehr abknöpft als angegeben. Wir werden das verfolgen, an dieser Stelle nur der dringende Hinweis, nicht bei diesem Verein zu buchen. Danke.
Nachdem wir am nächsten Tag unseren verlorenen Sohn doch noch in Empfang nehmen dürfen, machen wir uns frohgemut auf in Richtung Campbeltown, das wir nach einer durchaus extensiven Fahrt nach ca. drei Stunden vorbei am viel besungenen Loch Lomond und anschließend entlang des ebenfalls als bekannte Weise verewigten Mull of Kintyre erreichen (wo man, ohne Scherz, immer wieder vegetarische sausages der Marke Linda McCartney auf der Speisekarte findet). Dieser Küstenort in der immer wieder gerne zitierten Region Argyll (einmal alle gemeinsam: Arrrrrgailll!!) and Bute war einst die selbsternannte Whisky-Hauptstadt der Welt, Anfang des 20. Jahrhunderts tummelten sich über 30 Brennereien hier, bevor alles im Katzenjammer endete, als Prohibition und Wirtschaftskrise die Nachfrage aus den USA jäh beendeten. Dieses Flair einer vergangenen Glorie haftet dem Ort auch an, eine nicht gerade emsige Atmosphäre herrscht, wobei die lokale Gastronomie mit dem „Black Sheep“-Pub und einem zünftigen Fish&Chip-Shop doch einiges zu bieten hat
Heute überleben von dieser einstigen Pracht nur noch drei Vertreter, die wir uns heute in jedem Falle ansehen, auch wenn uns auf dem Weg ins Städtchen der Orkan fast umweht (Ausläufer des Hurricanes, der die USA plagte und zur Streichung aller Fährverbindung führt – wir werden sehen, ob wir unser Ziel Islay morgen erreichen). Station Eins auf unserer Reise ist Springbank, wo man besonderen Wert darauf legt, in traditioneller Art und Weise zu arbeiten und dies auch als „working museum“ vermarktet. Der gute Mann, der uns durch die Räumlichkeiten führt, erläutert in hartem Schottisch die Größenordnungen: man stellt hier pro Jahr 130.000 Liter Whisky her, während ein Großproduzent wie Glenfiddich zum Vergleich auf stattliche 40 Millionen Liter kommt. Die Mash Tuns sind noch ganz traditionell aus Holz (boat skin larch, also das Holz, aus dem auch die Wikinger ihre Boote bastelten) – klar sind die üblichen Edelstahl-Behälter viel pflegeleichter, aber bei Springbank macht man eben keine Experimente. Auch insgesamt wirkt die Brennerei so, als ob man sich direkt wieder in der Blütezeit Campbeltowns Anfang des 20. Jahrhunderts befindet – nur abstauben könnten sie vielleicht mal. Frazer erläutert uns die drei Varianten, die man hier herstellt: in dreifacher Destillierung entsteht der milde, nicht rauchige Hazelburn, den man schon zum Frühstück genießen könne; mit 2,8facher Destillierung, die man zum besseren Verständnis als 2,5 bezeichnet, kommt man zum Klassiker Springbank; und nur zweimal durch die Blasen läuft der betont rauchige Longrow. Zwischendurch können wir noch eine echte Legende bei der Arbeit beobachten: Head Master Frank McHardy huscht in sein Büro und wirkt schon allein dabei wie die Koryphäe, die die Legs eines Malts auch mal gerne mit denen von Frau Lollobrigida vergleicht. Vorbei an der hauseigenen Abfüllung und Verpackung, wo emsige Hände die Flaschen in die entsprechenden Kartons verpacken und auf die Reise um die Welt schicken, geht es zu den acht dunnage warehouses, in denen traditionell auf blankem Erdboden die Fässer ausschließlich vor Ort lagern. Weiter marschieren wir nun um die Ecke zu Glengyle – der Schwesterbrennerei, die man zur Jahrtausendwende wieder in Betrieb nahm, um zu gewährleisten, dass man nach wie vor genügend Brennereien in Campbeltown aufweisen kann, um offiziell als Whisky-Region firmieren zu dürfen. Dabei ging Besitzer Hedley Wright (seines Zeichens Nachfahre von Gründer William Mitchell) typisch schottisch sparsam vor und setzte auf gebrauchte Einrichtung: die Gerstenmühle erstand man für fürstliche 50 Pence von Aberlour, die Brennblasen holte man von der eingemotteten Ben Wyvis-Brennerei und ergänzte kurzerhand eigene Spitzen, um einen eigenen Brennerei-Charakter zu gewährleisten. Seit 2004 produziert man hier für ganze zwei Monate im Jahr und kann seit 2012 mit dem Kilkerran einen Standard bieten – aufgrund eines gleichnamigen Blends, dessen Namensrechte man vergeblich zu erwerben suchte, benannte man den Malt einfach nach dem gälischen Namen für Campbeltown. Wir schauen noch durch das kleine Gitterfenster in der Mauer in Richtung Kirchturm und erspähen so die Quelle für das Logo, das alle Kilkerran-Abfüllungen ziert, bevor es dann zum Warehouse Tasting geht, das wir – und das ist in jedem Falle ratsam – im Voraus bereits gebucht hatten, denn diese ausgesuchten Events sind gerne einmal ausgebucht, wenn man einfach vor Ort aufschlägt.
Dort erwartet uns schon die bezaubernde Jenna, die uns für Cadenhead, Schottlands ältesten unabhängigen Abfüller, der sich wie Springbank und Glengyle im Besitz der Mitchell-Dynastie befindet, durchs Programm führen wird. Wir starten gleich vielversprechend mit einem 29jährigen Linkwood aus der Speyside, der mit 46,5% hervorragend fruchtig-leicht daherkommt, als single cask nur noch bei einigen unabhängigen Abfüllern zu finden ist und seinen Weg in erster Linie in Blends nimmt. Während Jenna angeregt darüber plaudert, dass man bei Cadenhead Wert auf Qualität statt Quantität legt und familiär arbeitet, beobachten wir entzückt, wie die Dame den Stoff aus dem Fass zapft. Das nämlich erfolgt mit einem Valinch, einer Art überdimensionierten Pipette aus Metall, in die man oder frau per gefühlvollem Saugen die guten Tropfen emporzieht. Das regt die Phantasie wohlig an, so dass wir uns auch den nächsten Gesellen, einen 11jährigen Tomintoul mit 58,7% gefallen lassen, wobei uns dieser Speyside-Vertreter dann doch etwas ruppig erscheint. Jenna führt fröhlich aus, es gebe eigentlich kein Gesetz, wie man Whisky zu trinken habe, manch einer schwöre auf Whisky mit Irn Bru (einem legendären, neonfarbenen Erfrischungsgetränk) als hangover cure. Wir glaube dies gerne und sind gespannt, was Jenna nun aus dem Sherry Butt suckelt: einen 16jährigen Glen Scotia kredenzt sie uns nun, womit wir endgültig in Campbeltown angekommen sind. Mit 56,7% duftet der Vertreter hübsch nach Orange, während Jenna erklärt, man habe die Glen Scotia-Brennerei, die doch etwas in die Jahre gekommen war, vor kurzem runderneuert und mit neuem Spirit Safe und Besucherzentrum aufgemöbelt. Wir werden dies noch zu prüfen haben. Das älteste Fass im warehouse hier sei wohl ein Glen Grant von 1959, erfahren wir nun, der sei aber schwarz, stinkend und einfach nur „disgusting“ – Alter kann auch zum Nachteil gereichen und ist nicht das Maß aller Dinge, zumal der Zahn der Zeit in Form des angel’s share an dem Kollege nagt, der mittlerweile unter die 40%-Grenze gerutscht ist, ab der man ein Destillat als Whisky bezeichnet werden darf. Launig erläutert uns Jenna weiter, dass man bei Springbank 75 Leute beschäftigt und die Belegschaft sogar noch auszuweiten plant – im Vergleich eine extrem hohe Mitarbeiteranzahl, die beweist, dass traditionelle Methodik hier nicht nur marketingwirksam beschworen, sondern gelebt wird. Der Longrow, den sie jetzt aus dem Fass holt, durfte 15 Jahre im Weißweinfass verbringen. Mit 56,2% entfaltet dieser sehr torfige Vertreter eine ordentliche Kraft, die aber nicht zuletzt dank eines sanften, weinhaltigen Abgangs zu unserem bisherigen Favoriten avanciert.
Wunderbar! Anstelle prozyklischer Produktionsausweitung, wie dies in anderen Häusern üblich scheint (wir denken wir Grausen an die komplett neu entstehende, direkt aus Hobbiton entsprungen scheinende Ansiedlung, die wir im letzten Jahr bei Macallan durchwanderten), agiert man bei Springbank gemächlich und macht sich somit unabhängiger von Marktschwankungen. Brennerei-Politik der ruhigen Hand, sozusagen. Jetzt schenkt die Dame uns „an Islay“ aus, der es auf 9 Jahre im Fass und 59,9% an Stärke bringt. Der Name darf hier, wie bei so manchen unabhängigen Abfüllungen, nicht verraten werden, aber wenn man ein wenig hustet und räuspert, klingt das Ganze irgendwie nach Lagavulin. „It reeks of bananas!“, erläutert Jenna gerne und gibt spaßige Einblicke, wie die gerne beigepackten Tasting Notes entstehen. Jeder darf dazu etwas beitragen, wodurch dann auch launige Beschreibungen wie „like heading through a meadow on a donkey“ zum Zuge kommen. Hier gibt es in jedem Fall wunderbare Noten eben nach Bananen und weiteren dunklen Früchten, die wir gerne notieren. Last but not least kommen wir – selbstverständlich – noch in den Genuss eines 13jährigen Kilkerran, der mit 10 Jahren im Portweinfass und 3 Jahren Bourbon-Reifung mit 54% ein wirklich unvergleichliches Geschmackserlebnis bietet. Trotz ambitionierten Preises ringen wir uns durch – der muss mit, das hilft einfach nichts. Wunderbar. Woraufhin es aber leider endgültig heißt: wer hat an der Uhr gedreht? Das Cadenhead Tasting geht zur Neige, und wir müssen uns von Jenna verabschieden, natürlich nicht ohne ein standesgemäßes Zielfoto. Die Schätze, die wir gerne erstehen und eigens beschriften, werden uns im nahegelegenen Cadenhead’s Whisky Shop ausgehändigt, wo man uns dann frohgemut einen weiteren dram aus dem Springbank Living Cask kredenzt, das mit 57% verschiedene Jahrgänge vereint.
Eigentlich kann dieser Vormittag nicht übertroffen werden, und wir könnten nach Hause gehen. Geht aber nicht, denn schließlich kommen wir nicht umhin, Jennas (und unseres Landlords) Tipp zu folgen und uns für den Nachmittag spontan bei Glen Scotia einzufinden („they will accommodate you“, sagt man uns). Dort stehen wir erst einmal vor verschlossenen Türen, aber ein freundlicher Herr, der sich als Brennereileiter entpuppt, meint, wir sollten einfach einen Moment warten, der Tasting-Meister könne nicht weit sein. In der Tat öffnet sich alsbald die Türe zum wirklich geschmackvollen, hübsch getäfelten Tasting-Room, wo wir uns am Tisch versammeln und sogleich mit einem Glen Scotia Double Cask starten. Ohne Altersangabe, aber mit 46% bringt der Vertreter Lagerung in US-Eiche und finish in PX-Sherry-Casks in die Flasche und zaubert mit den für Ximenez typischen süßen Noten von Honig, Gewürzen und Keksen ein Lächeln auf unsere Gesichter. Tasting-Chef Callum Fraser witzelt ein wenig über das furiose frühere Design der Glen Scotia-Labels, das sich ausnimmt wie die Fantasy-Bilder, die man Ende der 80er per Paintbrush auf Automotorhauben zimmerte – „the guy was frowned upon“ ist dabei noch die sozialverträglichste Beschreibung. Das ficht uns nicht an, mittlerweile sind die Flaschen sehr schön gestaltet. Man hat in dem ohnehin kleinen Sortiment ausschließlich Nachreifungen im Programm, erfahren wir nun, während wir einen 8jährigen Vertreter probieren, der deutlich mehr hermacht als man bei dem Alter glauben mag („it punches well above its weight“, wie Callum feststellt). Mit insgesamt neun Mitarbeitern fabriziert man hier wohl eine halbe Million Liter pro Jahr, erzählt er uns nun, ein Glen Scotia sei üblicherweise leichter und fruchtiger als ein Springbank, was auch an der importierten Gerste liegen mag. Weil als nächstes eine Sherry-Reifung an der Reihe ist, kommen noch die mittlerweile durchaus absurden Preise für ex-Sherry-Fässer zur Sprache – der Rückgang des Sherry-Konsums führt dazu, dass man für entsprechende Fässer mittlerweile etliche hundert Pfund hinblättern muss, während schnöde Eiche für 50 Pfund zu haben ist.
Dennoch lassen wir uns den Geschmack des 18jährigen nicht verderben, der 17 Jahre in amerikanischer Eiche und ein letztes Jahr in Oloroso-Fässern verbrachte. Mit 46% kommt uns dieser Kollege salzig und würzig entgegen, fast ein wenig beißend im Geruch, während wir von den verschiedenen Methoden erfahren, mit denen Arbeiter gerne versuchten, sich ein wenig des kostbaren Nass aus den Fässern abzuzweigen – von der Zigarrenröhre über Wärmeflaschen bis hin zur legendären HP Brown Sauce-Flasche, die dem Dieb offenbar in flagranti entglitt und Jahre später in einem Fass aufgefunden wurde. Wir sind amüsiert, was sicherlich auch an den drams liegt, die nun mit einem 25jährigen in die nächste Runde gehen, der ausnahmsweise nur in Bourbon-Fässern gelagert wurde. 48,8% schlagen zu Buche, feurige Frucht kommt uns hier entgegen aus einem Destillat, das in der alten Ära noch vor Übernahme durch die Loch Lomond-Brennerei entstand. An die gute alte Zeit soll schließlich der Victoriana erinnern, der zu 70% in gekohlter Eiche und zu 30% in PX-Fässern heranreifte. Insgesamt zwölf Jahre und 51,5% bringt der viktorianische Herr mit, der uns aber nicht unbedingt zu Begeisterungsstürmen veranlasst. Das bleibt dann dem endgültig letzten im Reigen heute überlassen: die 10jährige Distillery Edition No. 4 wartet deutlich getorft auf, wobei die 17 ppm noch im Rahmen bleiben. Limitiert auf 210 Flaschen, entfaltet der „sneaky peat“ seine Wirkung erst ganz am Ende im ewig scheinenden Abgang, dem man die 57,2% nicht unbedingt anmerkt. „Der Kracher!“, sind wir uns einig, der Sieger der Glen Scotia-Versuchsanordnung steht fest. Gemeinsam mit unserem Zeremonienmeister amüsieren wir uns noch ein wenig über die nun sofort davon eilenden Mitverkoster, die zutiefst teutonisch-humorlos akribisch die mitgeführten Tasting-Bücher mit Skalen und Kreuzchen versehen haben – offenbar muss für die deutsche Seele auch hier eine Ordnung herrschen, Herrschaften! Muss sie nicht – „just enjoy“, so lautet unsere Empfehlung, die wir unbedingt allen ans Herz legen, die über lauter Geschmacksrädern und Fencheldufttabellen den eigentlich Sinn der Sache – den freudigen Genuss – zu übersehen drohen. Zurück beim Landlord dürfen wir die freudige Botschaft entgegennehmen, dass sich der Wind beruhigt hat und die Fähren morgen wohl wieder in Richtung Islay ablegen. Wir werden alles daran setzen, dabei zu sein – aber jetzt holen wir uns erst mal Fish&Chips.
Demnächst Folge 2: Von Campbeltown nach Port Ellen – wir setzen über!
Lies auch Teil 2 dieser Reise