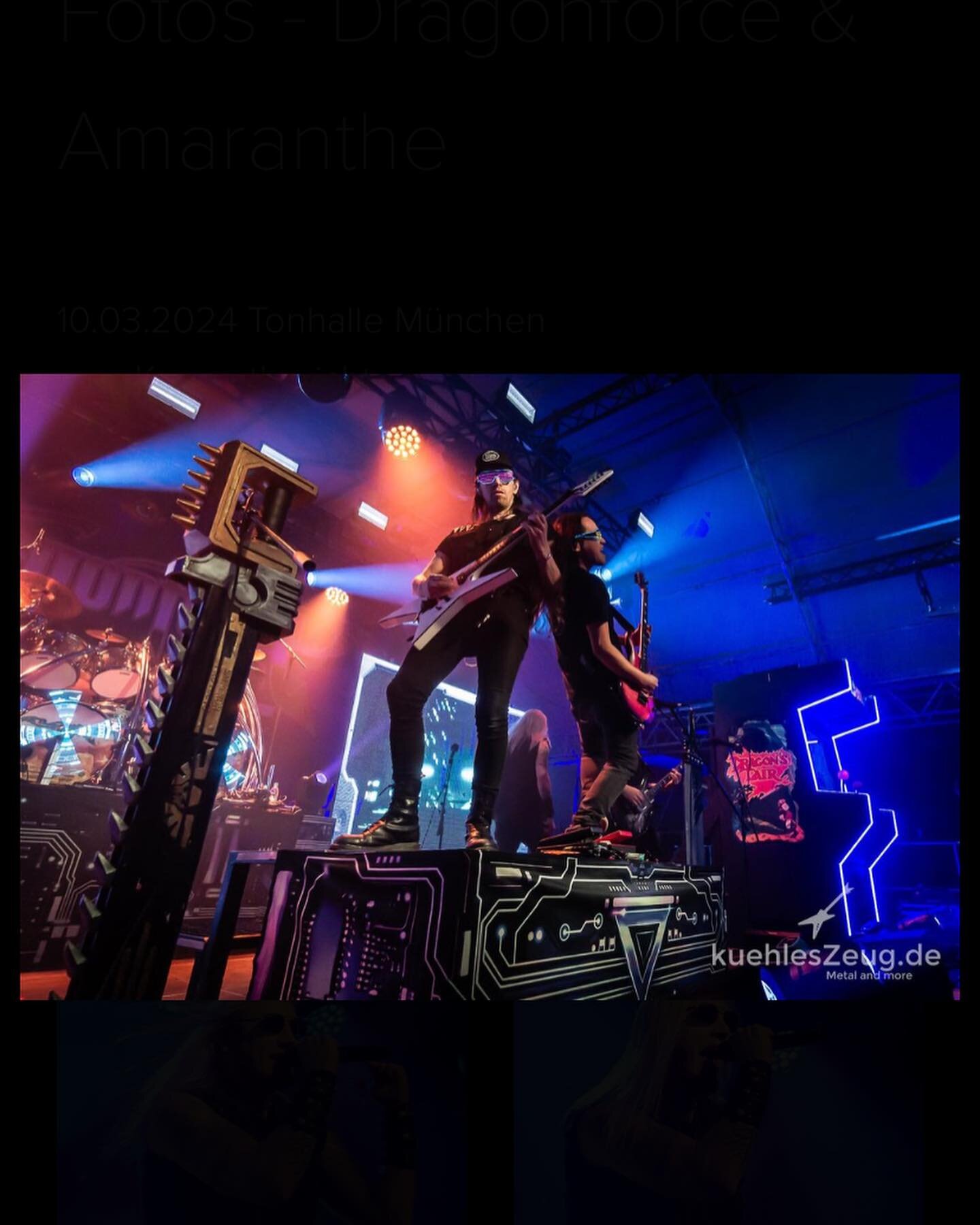Ein Kessel Buntes: Death Angel, Krisiun und Antipeewee bedanken sich bei uns
/27.07.2017 Backstage München
Free & Easy Festival
zu den Bildern
Death Angel gehören zu den Bay Area Thrashern, die es wie Exodus und Testament nie in die ganz vordere Reihe geschafft haben. Vollkommen zu Unrecht, fabrizieren die Jungs doch erfahrungsgemäß eine fulminante Attacke. Solch einen Abriss hätten allerdings selbst wir nicht erwartet. Und höflich waren sie auch noch allesamt.
Free And Easy, nächste Station: das Gelände des Freier-Eintritt-Festivals im Backstage ist erneut belagert und populär, die Schlange wickelt sich um die Ecken, und man holt sich geduldig das Einlassbändchen ab. Schon eine kurze Augenscheinnahme zeigt, dass es sich hier aber wohl in erster Linie nicht um Sympathisanten der Kombo handelt, wegen derer wir angereist sind: jede Menge rosa Leibchen werden da spazieren getragen. Richtig, die Franken-Blödel-Barden von JBO gastieren heute im Werk und mobilisieren die Menge. Dieses Orchester kennen wir ja noch bestens vom letzten (und finalen) Rockavaria und lenken die Schritte daher direkt in die Halle, wo der Inhalt des fetten Thrash-Pakets schon ausgepackt wird.
Antipeewee - mehr Bilder
Dafür hat man sich lobenswerterweise wieder Lokalmatadoren an Bord geholt, dieses Mal sind es die Abensberger von Antipeewee, die eine schlanke Sohle aufs Parkett legen. Die wilde Bande um Fronter Philipp Schnepka (auch genannt PeeWee, daher der Bandname – also keine Referenzen auf US-Filmkomiker beabsichtigt) feuern eine wilde Mischung aus Exodus, Anthrax, Suicidal Tendencies und anderen Einflüssen heraus und haben daran offenkundig jede Menge Freude. Kein Wunder, zeigt sich die Halle doch bereits jetzt gut besucht und voller Schlachtenbummler, die offenkundig Lust zum mitmischen haben. Die Gitarrenfraktion aus Coralie Baier und Johannes Scheugenpflug steht wie eine Eins, Basser Alexander Schott hat sein Destruction-Tour-Shirt von 1984 sicherlich nicht seinerzeit vor Ort erworben, aber die old school Fahne weht hier sehr ordentlich. „Wir wollen Euch hübsch machen!“, ruft uns Philipp zu – na, viel Glück bei dieser Mission, das wird ein hartes Stück Arbeit, aber Nummern wie „Rotten Smell Of Dirty Lies“ oder „Desecration“ sorgen im Pit doch tatsächlich für die ersten Mixer-Anflüge des Abends. Besonders lobenswert: der Schlagwerker hat sich das gesamte Material dem Vernehmen nach in zwei Wochen draufgeschafft – Prospekt, der Herr! Mit „Cool Guy Cthulhu“ (also, der muss ja wirklich oft herhalten, bekommt der gute HP Lovecraft eigentlich Tantieme dafür?) und „Separate The Head From The Body“ (garniert mit einer politischen Aussage gegen rechts) biegen sie auch schon auf die Zielgerade ein – und finden tatsächlich noch die Gelegenheit zu einer kleinen Zugabe: „Attack The Brewery“ läuft gut rein, bevor dann Schluss ist.
Krisiun - mehr Bilder
„Das ist ja ein Familienfest der Generationen!“, kommentiert Soziologe Sebbes die Alters- und Sozialstruktur der Angereisten, unter denen sich offenkundig wirklich ganze Clans befinden, vom Sohnemann bis hin zur respektablen, aber dennoch kuttentragenden Mama. Wir sprechen noch kurz mit den geschätzten Branchenkollegen (man kennt sich eben mittlerweile), dann geht es auch schon weiter im Text mit Krisiun. Nach einem kurzen Tribal-Intro rührt der Dreier aus Brasilien (benannt nach dem Mondkrater Mare Crisium) sein Todesblei mit enormer Energie an, Tieftöner Alex Camargo grunzt sich standesgemäß durchs Geschehen und ist rein optisch kaum von Saitenbieger Moyses Kolesne zu unterscheiden – kaum verwunderlich, haben wir es hier doch mit einem Brudertrio zu tun. Irgendwo in der Mitte zwischen Florida-Death, Doom, Grindcore und Thrash pfeffern die Herren uns die Stücke um die Ohren, wobei es neben grooving-doomigen Elementen auch immer wieder fette Blastbeats gibt, die Drummer Max Kolesne im wahrsten Wortsinne aus dem Handgelenk schüttelt: immer wieder schmettert er die Sticks derartig schnell auf die Felle, dass das Duracell-Häschen dagegen eher tranig wirkt. Großes technisches Kino! „Das ist eher keine romantische Musik!“, stellt Date-Doktor Sebbes treffend fest, während Alex damit beginnt, sich wiederholt und schließlich permanent bei uns, beim Backstage und der ganzen Welt zu bedanken – für die Einladung, die Energie, den Support für underground-Musik und für das Leben an sich. Das kommt ehrlich rüber, wirkt sympathisch und gereicht allenthalben zur Freude. „Die sind ja wirklich galant!“, urteilt Knigge-Leser Sebbes, während uns Alex weiteren „old school shit“ ankündigt, der mit „Vengeance‘s Revelation“ und dem mächtigen „Blood Red“ auch nicht lange auf sich warten lässt. „Danke scheeen München!“, schallt es uns wieder entgegen, und jetzt steht ein „timeless classic“ an, „a tribute to the greatest frontman of all time“ – es werden keine Preise ausgelobt, wer das denn gewesen sei, in dieser Kategorie kann es natürlich nur einen geben, der nun mit einem krachigen Cover von „Ace Of Spades“ geehrt wird, wozu die Meute am kollektiven Rad schraubt. Trotz aller düsteren Attitüde gibt man sich auch launig, Gitarrist Moyses parliert in passablem Deutsch „Was ist los, Junge? Hast Du getrunken oder was?“ Eine wunderbare Abfahrt – und selbstverständlich bedankt sich Alex nochmals bei uns, bevor man sich verabschiedet.
DEATH ANGEL - mehr Bilder
Für die kommende Attraktion wird die Bühne, das kennt man ja mittlerweile sattsam, deutlich auskömmlicher, auf den Gitarrenracks lagern zwei Plastik-Lurchis, mit konsequent hochgezogenen Socken gibt der Bühnentechniker ein Fashion Statement ab, aber er bekommt die anfänglichen Probleme mit dem Bass in den Griff. Zur besseren Sicht und zum vorteilhafteren Anfertigen von Fotografien begeben wir uns kurzerhand mittig in die ersten Reihen – ob das gutgeht? Nun, wir werden sehen, schon bei den ersten Gitarrentriolen von „The Ultra-Violence“ vom legendären Death Angel-Erstling geht eine Welle durch die Menge. Mit Kompletteinstieg verwandelt sich das erste Drittel dann in ein Tollhaus – der Moshpit regiert, wie das bei einer Thrash-Ansetzung eben sein muss. Mit äußerster Präzision zimmern Rob Cavestany und Ted Aguilar die Riffs und Melodien dabei ins kochende Rund, wobei sich Fronter Mark Osegueda als optischer und auch greifbarer Mittelpunkt zementiert: er springt, dräut, kauert und feuert in die Menge, als ob das hier der letzte Auftritt aller Zeiten wäre, schreit die vorderen Reihen aus nächster Nähe an und schüttelt im gleichen Moment ungezählte Hände, genau wie Basser Damien Sisson (Fashion Statement, Part Deux: Schlaghose. Word!) permanent abklatscht und die Ghettofaust macht. Eine nicht gerade hünenhafte asiatische Dame neben mir verschwindet bei jeder Anbrandung des Körpermeeres, taucht aber zuverlässig stets immer empor und verheddert sich dabei gerne – „sorry but your hair is tangled up in my shirt!“, so etwas kann man auch nicht alle Tage ungestraft zur holden Weiblichkeit sagen. Heute geht das, „Left For Dead“ entfesselt den Pit noch mehr, während Sebbo und seine Kollegen im wogenden Ozean umherschwappen und dabei versuchen, Bilder zu erhaschen.
DEATH ANGEL - mehr Bilder
Herr Aguilar (mit Aguirre nicht verwandt) zaubert nun eine à la Toni Iommi beleuchtete Gitarre hervor, auf der die exzellenten Granaten „Son Of The Morning“ und „Father Of Lies“ (vom aktuellen Langdreher „The Evil Divide“) eine herausragende Figur machen. Nun stellt sich heraus, dass man offenbar eine Wette laufen hat: wer kann sich häufiger beim Publikum bedanken? Herr Osegueda versucht in jedem Fall sein Möglichstes, bedankt sich endlich wieder hier sein zu dürfen, immerhin verbinde man mit „fucking Munchen“ beste Erinnerungen, man habe „lots of material for people who like to celebrate music“ dabei. Damit meint er wohl uns, wir stimmen freudig zu und werfen uns bei „Caster Of Shame“ wieder massiv in die Bresche. Auch wenn heute nicht ganz so subtropische Temperaturen herrschen wie sonst üblich, scheinen die Herren auf der Bühne bald so gebadet wie wir, weshalb Mark erst einmal einen gediegenen Schluck Bombay Gin zu sich nimmt. Das nächste Stück, so informiert er uns, sei über „unity in metal, and this requires movement!!“ Das verstehen wir, und offenkundig auch so mancher Schlachtenbummler ganz besonders gut, so wie ein etwas orientierungsloser junger Mann, der in den vorderen Reihen in erster Linie seitwärts umherirrt und vergeblich versucht, die Bühne zu erklimmen. „Aha, das war der Movement!“, stellt Massenpsychologe Sebbes fest, und den Kollegen treffen wir im Verlauf des Abends noch häufiger. Anderen Feierwütigen gelingt das Unterfangen dann deutlich besser: die Crowd Schlürfer und Stage Driver übernehmen das Ruder, beehren die Kombo auf der Bühne und stürzen sich wohlgemut wieder hinein ins Getümmel.
DEATH ANGEL - mehr Bilder
Beim nun folgenden „Lost“ – einer Hymne für alle, die sich ob ihrer Persönlichkeit ausgegrenzt fühlen, Respekt, Mark bedankt sich schon einmal prophylaktisch bei allen – liefert dann mit etwas gemächlicherem Riffing und Cleangesang den wunderbaren musikalischen Höhepunkt. Herausragende Qualitätsarbeit! Ansatzlos geht es ins Black Sabbath-Cover „Falling Off The Edge Of The World“, das die Todesengel doch etwas beschleunigt haben und dennoch kongenial darbieten, komplett mit feiner vokalistischer Leistung. Jetzt geht es wieder ganz weit zurück in die Historie, genauer gesagt zum Erstling der ultra-Gewalt, wozu uns Mark quasi eine Gebrauchsanweisung gibt: „If you know that is is from the Ultra Violence, then you know how to act, or better how to react to it!“ Das nimmt nicht nur der Herr Movement zum Anlass, die Wurstmaschine wieder anzuwerfen: ein fröhliches Tanztreiben herrscht überall, was Sozialpädagoge Sebbes als „Freizeitpark für Metaller!“ einklassifiziert. Sämtliche Nachbarn (inkl. asiatischer Dame, Knopfproblem mittlerweile gelöst) wogen hin und her, nehmen sich vor Fliegern in acht und studieren das exakt gleiche Schuhwerk aller Akteure auf der Bühne, wenn wir nicht gerade „Kill – as – one!!“ skandieren (einer der weniger bekannten Tippfehler der Metal-Historie, das Lied heißt im Original-Demo natürlich „Grill as one“, zu Deutsch so viel wie „Grill wie ‘ne Eins!“) Nach „Relentless Revolution“ stellt Meister Mark nun die Band vor – unter anderem „my brown man with a white guitar“ Ted und Drummer Will Carroll „who is more underground than you will ever be“. Nun, ob der Mann bei der Londoner U-Bahn tätig ist, wissen wir nicht – in jedem Fall verdrischt er die Felle nach allen Regeln der Kunst mit fliegendem Wikinger-Bart. „So, this is my least favorite moment: the moment when I tell you this is the last song!”, referiert Mark nun, man meine das auch Ernst: nicht die üblichen Spielchen “where you chant our names and we act surprised – no, this is your last chance to make a mutual impression!” Und diese Chance des beidseitig bleibenden Eindrucks nutzen die Anwesenden weidlich aus: “This is OUR moth song!“, mit diesem kleinen Seitenhieb auf Metallica (die seit Neuestem ja auch einen Mottensong an Bord haben) wirf Mark sich in „The Moth“, das zur letztendlich gültigen Abrissbirne gerät. Der Boden bebt so, wie Herr Osegueda das von uns verlangt, der Mixer läuft auf Hochtouren, die Menge schäumt über – und aus ist’s. Selbstverständlich bedankt man sich bei uns – wir bedanken uns mittlerweile auch schon gegenseitig bei uns selbst -, bevor wir in die regnerische Nacht entlassen werden. Welche eine Dampfwalze! Death Angel genießen ihren hervorragenden Ruf nicht umsonst, das haben sie auch heute wieder zweifelsfrei unter Beweis gestellt. Wir sind verzückt, wandern am Werk vorbei, das die Spaßfraktion längst geräumt hat, und staunen dann auf dem Parkplatz noch darüber, dass die Münchner Thrash-Fraktion in nicht geringer Zahl in Limousinen aus dem Premium-Segment angereist ist. Metal ist eben in der gehobenen Mittelklasse angekommen. Thank you.
DEATH ANGEL - mehr Bilder