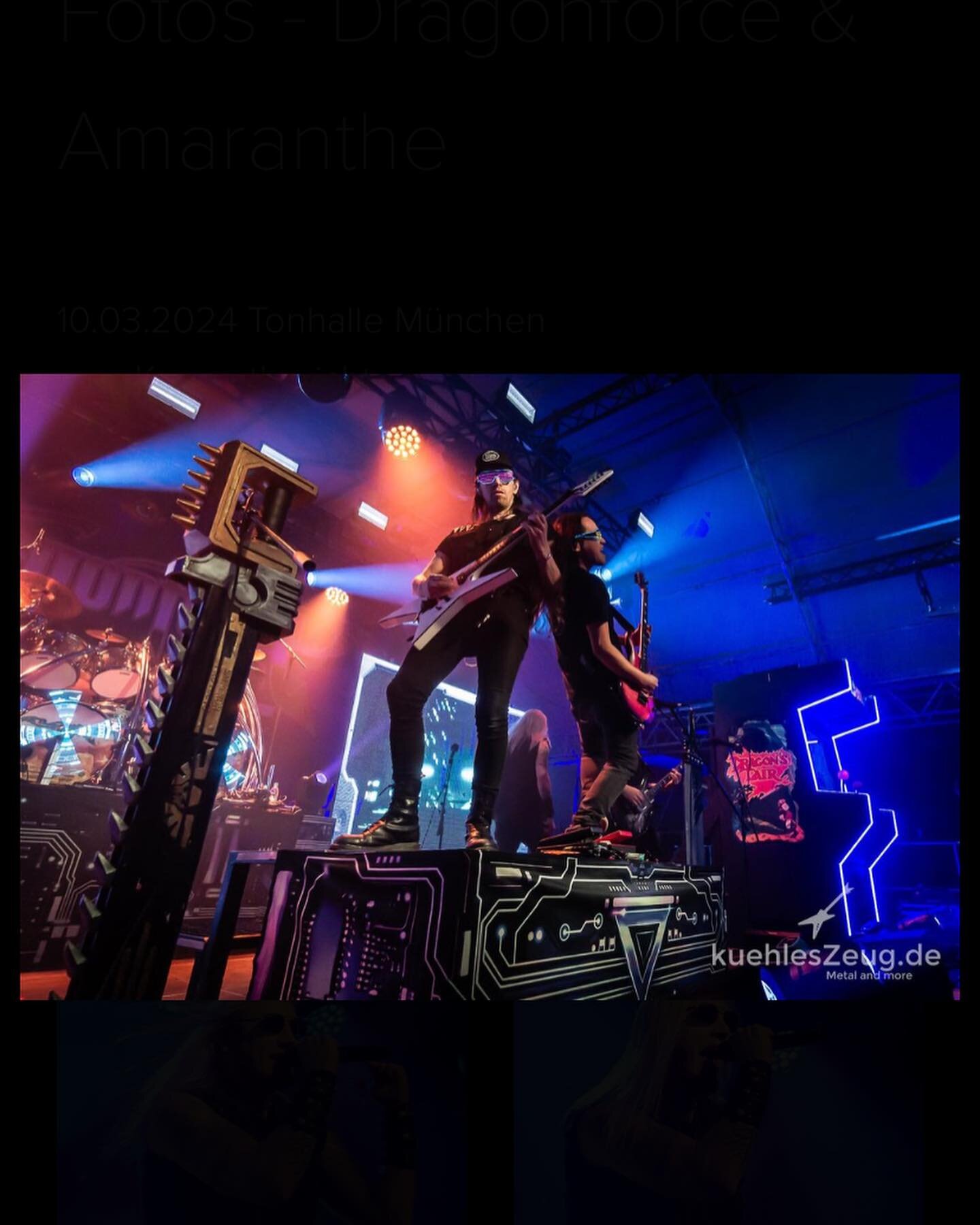Fürwahr, eine königliche Freude: wir rocken den King mit Sabaton, Powerwolf und Freunden!
/29.07.2017
Rock the King in Kempten
zu den Bildern
Hochkarätige Bands, und zwar gleich mehrere davon. Mehr als zivile Preise. Kompaktes Ein-Tages-Format. Und das auch noch in durchaus machbarer Reichweite für uns? Wenn in Kempten der schwäbische Bär steppt, sind wir dabei!
„Achtung! Parkplatz-Standort merken!“ Das steht auf dem kleinen Zettel, den man von den freundlichen Damen erhält, sobald man den Obolus entrichtet hat und auf die Parkwiese steuert. Das sollten wir hinbekommen: das Areal ist überschaubar, ebenso wie die gerade einmal vier Euro, für die wir getrost den ganzen Tag stehen dürfen hier. So ist das eben beim Rock the King: familiär, herzlich, fair und äußerst gelungen. Mit ein paar kleinen Ausnahmen, über die zu sprechen sein wird.
Nach dem traurigen Ableben des Rockavaria nehmen wir erfreut zur Kenntnis, dass sich nahe Kempten im beschaulichen Allgäu ein neues Festival in Süddeutschland zu etablieren versucht. 2016 ging die Sause schon einmal über die Bühne, allerdings an anderer Stelle: da hatte der Veranstalter Allgäu Concerts noch in den Barockgarten des Festspielhauses in Füssen geladen, wo unter anderem Saxon, Subway to Sally und Kissin‘ Dynamite vor 4.500 Angereisten aufspielten. In diesem Jahr schließlich pilgerten 6.500 Fans nach Buchenberg, das zumindest schon einmal einen Rekord vermelden kann: mit 900 Metern dürfte man mit Fug und Recht das am höchsten gelegene Festival Deutschlands sein. Und sicherlich auch das günstigste: für gerade einmal 64 Euro stehen zwei volle Headliner-Shows der metallischen Champions League-Teilnehmer Powerwolf und Sabaton auf dem Programm, garniert mit Festival-Dauerbrenner „uns Udo“ Dirkschneider, Schandmaul und Megaherz. Einzig die deutschen Elektro/EBM-Rocker Oomph! fallen da etwas aus dem Rahmen und bieten eine Wundertüte – wir lassen uns aber gerne überraschen.
Idyllisch geht die kurvenreiche Anfahrt denn an garantiert biologisch gehaltenen Kühen vorbei bis hin zur „Concert Arena“, die sich als – Wiese herausstellt. Das kann durchaus zum Problem werden: immerhin hat es in den Tagen zuvor wie aus Kübeln geschüttet, der Boden ist entsprechend aufgeweicht und stellenweise matschig. Firlefanz allerdings gegen die Verhältnisse, mit denen man sich in Wacken streckenweise herumschlagen darf – zumal pünktlich zum Konzerttag am Samstag die Sonne herauskommt. Am Vorabend gab es schon eine warm-up-Party, bei der Bloodhound Gang-Basser Evil Jared auflegte und im Rahmen eines Bandcontests die Kombo gekürt wurde, die den Reigen am Samstag eröffnen darf. Das hat gute Tradition, das macht man in Wacken und Balingen beim Bang Your Head genauso, und auch einen anderen Brauch hat man sich abgeschaut: die ersten Takte darf die Musikkapelle Buchenberg spielen, wie das ja in Wacken die Feuerwehrblaskapelle unter dem Titel „Wacken Firefighters“ seit Jahren hält. Die Kollegen zeigen sich durchaus launig – der eine oder andere bleibt sogar, um dem bunten oder eher schwarzen Treiben der jungen Leute auf der Wiese noch eine Weile zuzuschauen. Wir sehen uns derweilen ein wenig um, erstehen selbstverständlich ein Leibchen der Veranstaltung (15 Euro für ein Shirt – von solchen Preisen können andere Festival-Besucher nur träumen) und stellen fest, dass das Camping-Areal, wie auch der Parkplatz, in nächster Nähe zum Festivalgelände positioniert sind (wer’s mag: das Camping-Ticket kostete gerade mal 15 Euro). Die kleine VIP-Tribüne mit guter Sicht und freien Häppchen ist ebenfalls bevölkert – für 180 EUR gibt’s das Festival in dieser deluxe-Variante, wobei sich von überall ein guter Blick erhaschen lässt, zumal man auch bei den Hauptacts noch relativ leicht bis nahe an die Bühne herankommt.
Meister Ehder - zu den Bildern
Jetzt dürfen aber erst einmal die Lokalamatadoren ran, die den Bandcontest für sich entscheiden konnten: Meister Ehder aus Kempten kredenzen der durchaus schon beachtlichen Menge eine sehr ordentliche Portion von deutschsprachigem modernem Hard Rock, vermengt mit leichten Anklängen an die selige Neue Welle. Sänger Immanuel Dittmer agiert dabei anfänglich in Zwangsjacke, derer er sich allerdings bald entledigt und wie seine gesamte Kombo, die gerade erst einmal ein Jahr exisitert, eine mehr als saubere Leistung aufs Parkett legt, so dass die zwanzig Minuten Spielzeit im Fluge vergehen.
Wir wandern ein wenig weiter übers Gelände und entdecken dabei gleich mal einen Geheimtipp: über einen kleinen Umweg frei zugänglich gelangt man hinter den Bühnenaufbau zu einer Halle, in der gestern offenbar die Party und der Bandcontest gestiegen sind. Davor stehen ein paar Festbänke herum, die gerne genommene Sitzgelegenheiten und Schatten bieten, immerhin brennt die Sonne mittlerweile ganz schön herunter. Leider macht der hier geparkte Getränkestand just in dem Moment zu, als wir eintrudeln – womit wir schon beim größten Manko des ansonsten durchweg gelungenen Events wären. Für die genannten, mehreren tausend Schlachtenbummler stehen draußen gerade einmal zwei Getränkestationen zur Verfügung, die mit dem Ansturm naturgemäß heillos überfordert sind, auch wenn sich die Mannschaften dahinter redlich mühen. Gerade bei der Hitze nicht gerade dienlich, wenn man auf ein Bier, Wasser oder sonstige Erfrischung locker 20 Minuten warten muss, weshalb manch einer das Unterfangen genervt abbricht. Bitte nächstes Jahr mindestens dreimal so viele Anlaufstellen – das sollte sich ja auch umsatztechnisch lohnen.
MEGAHERZ - zu den Bildern
Wir lassen uns nicht verdrießen, sondern eilen zur Bühne, wo nun die Münchner Neue Deutsche Härte-Pioniere von Megaherz mit „Willkommen im Zombieland“ in ihr Set einsteigen. In der üblichen Kriegsbemalung, die teilweise an den Violator aus Spawn, teilweise an Bele und Lokai aus einer lustigen Folge Star Trek erinnert, feuern die Jungs um Fronter Alex Wohnhaas die stampfenden Beates heraus. Der Shouter schwingt locker einen zum Mikroständer umgebastelten Baseballschläger und zeigt sich erstaunt ob des guten Zuspruchs: „Leute, es ist erst 14 Uhr, und trotzdem schon so viele da!“ Das motiviert, und so schwingt man sich munter durchs Programm, das mit „Glorreiche Zeiten“ weiter klar in der Schnittmenge zwischen Rammstein und dem eigenen Ableger Eisbrecher marschiert. Gestern sei man noch mit Marilyn Manson in Dresden aufgetreten, referiert Herr Wohnhaas, aber das heute mache auch enorm Laune – trotz der Hitze, „hoffentlich läuft mir das Make Up nicht weg“! Spätestens der Tanzboden-Klassiker „Miststück“ sorgt für die ersten Hüpfattacken im Publikum, wofür auch Schlagwerker Jürgen Wiehler sorgt, den wir unter dem Namen „Bam Bam“ ja noch aus Bonfire-Tagen kennen. Das sehr melodische „Roter Mond“ vom aktuellen Album gefällt gut, das gefühlvolle „Für immer“ widmet man Chris Cornell und Chester Bennington, bevor dann das groovige „Jagdzeit“ nochmals in Kontor schlägt und „Himmelsstürmer“ einen gelungenen Schlusspunkt setzt. 60 kurzweilige Minuten, die einen standesgemäßen Auftakt liefern. Im April sind sie wieder auf Tour, mit neuem Album im Gepäck.
Schandmaul - zu den Bildern
Wir pilgern kurz zurück hinter die Bühne, lassen uns nieder, stellen fest, dass der Getränkewagen immer noch geschlossen hat, dass es hier hinten aber einen Brunnen mit Wasser für alle und sogar Duschen für die Zeltfraktion gibt. Das kühle Nass wird gerne in Anspruch genommen. Jetzt aber wieder nach vorne, denn nun entern die Mittelalter-Folk-Kumpane von Schandmaul die Bühne. Die Gröbenzeller haben sich mittlerweile ja zum Dauergast auf Festivals gemausert und füllen daheim locker größere Hallen wie das Zenith. Auch heute bevölkert die bunt zusammengewürfelte Truppe aus Spielleuten fröhlich die Bühne, von der lederhosentragenden Saitenfraktion über Seebär Thomas Lindner bis zur Flöten-/Geigen-/Schalmei-Front aus Anna Katharina Kränzlein und Birgit Muggenthaler, die beide im schmucken Schottenrock aufspazieren. Thomas stellt gleich zu Anfang fest, man sei hier das „Kontrastprogramm zu den ganzen harten Jungs“, aber der Stimmung tut das in keiner Weise Abbruch: auch im Allgäu kennt man die Stücke wie das schöne „Lichtblick“, bei dem Herr Lindner selbst zur akustischen Klampfe greift, oder auch das lustige „Die letzte Tröte“ und singt beherzt mit. Jetzt komme ein Stück bayrisches Kulturgut an die Reihe, erklärt Thomas, welches der gute Bully Herbig verfilmt habe: „Kaspar“ erzählt die unverwüstliche Geschichte von Bandlkramer, der sich am widerspenstigen Brandner Kaspar die Zähne ausbeißt, äußerst unterhaltsam. „Die vorherrschende Farbe hier ist schwarz, aber das ist in jedem Fall besser als braun!“, sagt Thomas nun die Anti-Rechts-Hymne „Bunt und nicht braun“ an. Jetzt sollen wir uns alle hinknien, „nur Leute mit Knieproblemen sind entschuldigt“ – ok, machen wir, und hüpfen zu „Vogelfrei“ gerne im Takt. Das als „Sauflied“ angekündigte „Der Teufel hat den Schnaps gemacht“ läuft mit fröhlichem „Na und?“ im wahrsten Wortsinne bestens rein, bevor Herr Lindner sich bei den anderen Kombos freundlich dafür entschuldigt, dass er sich erdreistet, schon ein wenig Kraft des Publikums zu beanspruchen. Der 30.04. liege zwar schon ein wenig zurück, aber dennoch sei es nun an der Zeit, dieses Datum zu feiern – die „Walpurgisnacht“ zündet auch heute bestens und gehört zu ihren gelungensten Stücken. Flugs ist das Set vorbeigeflogen, man hat sogar noch etwas Spielzeit übrig, die man mit „Der Pakt“ füllt und dazu kollektives Beineschwingen fordert. Nach der von Thomas so bezeichneten „Liebesschnulze“ „Dein Anblick“, die von nicht wenigen inbrünstig mit intoniert wird, ist aber enggültig Schluss auf der Burg. Schöner Farbtupfer, dank viel akustischer Einsprengsel eine hübsche Abwechslung vom restlichen Hartwurst-Programm – und bald demnächst wieder auch in einem Theater in ihrer Nähe.
Oomph! - zu den Bildern
Durchaus gespannt sehen wir nun der nächsten Attraktion entgegen – so richtig präsent war das Trio aus Braunschweig zumindest für uns nicht, das unter dem Namen Oomph! 2004 mit ihrem Megahit „Augen Auf!“ derart omnipräsent war, dass sich sogar Thomas Gottschalk in Wetten Dass…? fragte, „was denn das mit diesem Eckstein“ solle. Mit dem kontroversen Nachfolgehit „Gott ist ein Popstar“ taten sie sich 2006 nochmals hervor, bevor es dann wieder etwas ruhiger um die drei Herren wurde. Ganz weg waren sie allerdings nie, 2015 traten sie zum 25jährigen Bandjubiläum in Wacken auf und legten eine sinnigerweise „XXV“ betitelte neue Scheibe vor. Wir sind somit großzügig und nehmen den Ausflug ins Allgäu mal als Teil der Jubiläumstournee, und wir werden belohnt: Oomph legen eine mitreißende Show hin, die deutlich unterstreicht, dass sie deutlich mehr auf Lager haben als zwei alte Hits. Vom Opener „Alles aus Liebe“ weg legen sich Dero, Flux und Crap (im englischsprachigen Ausland ein eher unglücklich gewählter Künstlername, aber nun denn) voll ins Zeug, komplett in düsterem Schwarz gewandet und wahlweise auch bis unters Kinn entsprechend bemalt. Dero tigert wild geworden über die Bühne, feuert die Menge an und intonier trittsicher kurz „We will rock you“, bevor er sich zu „Labyrinth“ dreht und windet, als ob wirklich kein Weg von der Bühne führen würde. Die Menge ist wohl genauso überrascht wie wir, goutiert das Geschehen zunehmend und bereitet den drei Herren und ihren Gastmusikern einen derart warmen Empfang, dass sich die Spielfreude oben immer mehr steigert. Nach der Gollum-Hommage „Mein Schatz“, zu der Dero sich als Percussionist Nummer Drei verdingt (neben dem Schlagzeuger ist ohnehin ein weiterer Fellgerber im Dienst), kredenzen sie uns das feine „Träumst Du“, mit dem sie 2007 gemeinsam mit Die Happy-Frontfrau Marta den Bundesvision Song Contest für Niedersachsen gewannen. „Feiert Euch selbst!“, fordert Dero uns auf, was wir gerne tun, „Hier ist Niemand!“ Wir sind ein wenig verwirrt, ein paar Leute sind doch durchaus anwesend – aber Dero meint wohl doch eher das gleichnamige Stück. Gut bei Stimme gut gelaunt, zeigt sich der Fronter agil und bestens aufgelegt, fordert unsere „Pommesgabeln de luxe“ und wirft sich zu „Jetzt oder nie“ von „XXV“ weiter in die Bresche. „Könnt Ihr noch lauter sein als das? Ich will einen akkuraten Moshpit!“, zündet Dero die Lunte weiter an und wird auch mit durchaus beachtlicher Bewegung im Zuschauerraum honoriert. Flux und Crap (teilweise auch am Keyboard aktiv) zimmern die Riffs mit stoischer Präzision, die Songs klingen allesamt einen Zacken härter als auf Konserve, was hier und heute bestens passt – „Mitten ins Herz“ vom 95er-Album „Defekt“ stampft mit einem gnadenlosen Rhythmus alles nieder, während Dero sich über die Absperrung hinweg beherzt in die Menge stürzt und somit als erster Crowdsurfer des Tages gelten muss. Respekt! „Sandmann“ ballert ordentlich, der gute Heinz Rühmann hätte sich wohl im Traume nicht vorstellen können, dass sein hübsches „La le lu“ einmal zu einer solch geisterhaften Weise mutieren würde. Melodisch-groovig wird es dann zu „Jede Reise hat ein Ende“, einer weiteren neuen Nummer, die zeigt, wie sich ihr Stil über die Jahre gewandelt hat. Den krönenden Abschluss bieten dann aber naturgemäß die beiden Nummern, mit denen Oomph! die größten kommerziellen Erfolge landete: „Gott ist ein Popstar“ gerät schon zum großen Mitschreifest, aber bei „Augen Auf!“ inklusive spannungsgeladenem Abzählen gibt es dann kein Halten mehr. Entzückung allenthalben, das Stück knallt wie am ersten Tag – massive Attacke, die Herren! So unerwartet wie die ganze Sause dann auch die Zugabe: nur begleitet vom Keyboard, bringt uns Dero eine schöne Version des Lionel Ritchie-Schlagers „Easy“ dar. Auch wenn ich nach wie vor unschlüssig bin, was es denn eigentlich bedeutet, einfach wie ein Sonntagmorgen zu sein: anders als im Falle der grauenhaften Faith No More (auch hier bleibe ich ratlos, was denn so ein „Glaube nicht mehr“ ist) bildet diese Nummer heute in keiner Weise den einzig hörbaren Aspekt im Geschehen. Ganz im Gegenteil, Oomph! haben massiv abgeräumt, und vielleicht heißt es bald wieder: Augen auf, sie kommen!
Dirkschneider - zu den Bildern
Eigentlich wollte er doch endgültig mit seiner Vergangenheit abschließen, der gute Herr Dirkschneider – deshalb ging „uns Udo“ ja letztes Jahr auf groß angelegte Back To The Roots-Tour, bei er ausschließlich Material seiner Schaffensphase bei Accept darbrachte, die die gleichen Nummern mittlerweile ja ebenfalls wieder präsentieren. Ab dem Abschlusskonzert in Solinger im Dezember sollte es nur noch Stücke aus seinem eigenen Kanon unter der Flagge U.D.O. geben. So der Plan. Aber manchmal kommt es eben doch anders: sei es nun der durchschlagende Erfolg der Ansetzungen, sei es die neu entdeckte Freude an den alten Perlen: der Tross geht in die (mindestens) zweite Runde, Back To The Roots Part Deux sozusagen. Wir sind also durchaus frohgemut, als Filius Sven Dirkschneider sich hinters Drumkit schwingt, die U.D.O.-Kombo die Bühne entert und zu den ersten Takten von „Starlight“ auch Mr Reibeisen himself auf den Plan tritt. Hier ist alte Schule angesagt, keine Frage, klassischer Metal der teutonischsten Art, von Udo und seinen Freunden wie immer blitzsauber dargebracht. Sofort am Start ist auch das fast schon notorische Ballett, das wir ja aus Accept-Tagen noch kennen, als das krachige Set mit „Living For Tonite“ nahtlos weitergeht. Musikalisch ist das natürlich deutlich anders als das Geschehen bislang, aber wichtig ist: der auch an Leibesfülle imposante Udo in den etatmäßigen Tarnhosen und Springenstiefeln röhrt wie in besten Tagen, da gibt es kein Versehen. Mit „Flash Rocking Man“ greift er nun in der Tat sehr tief in die Mottenkiste, mit den damals schon textliche kuriosen „London Leatherboys“ und dem Single-Klassiker „Midnight Mover“ (astreines Gitarrenflirren inklusive) geht es dann in die Balls To The Wall/Metal Heart-Historie, was die Menge gebührend abfeiert.
Dirkschneider - zu den Bildern
Kompromisslos, hart und doch melodisch ballert dann der „Breaker“ daher, wobei man an dieser Stelle eins zugestehen muss: die Saitenfranktion mit Andrey Smirnov und Bill Hudson macht ihre Aufgabe tadellos, aber an die mühelose, rasiermesserscharfe Kunstfertigkeit des Originals Wolf Hoffmann reichen sie nicht ganz heran. Das tut der Sause aber keinen Abbruch, die mit dem ausladenden Mitsingfest „Princess Of The Dawn“ ohne Pause fortgeführt wird. Die ohnehin gutgelaunte Security steigt voll ins Geschehen ein und zeigt sich ohnehin den ganzen Tag über freundlich und entspannt – am Ende verteilen wir dann gemeinsam Gummibärchen in die ersten Reihen. Metaller sind eben ganz harte Hunde. Die Menge feiert die Kombo mit Sprechchören ab, „Restless And Wild“ kommt leider nur etwas verkürzt an die Reihe, aber dafür gibt es denn ruppigen „Son Of A Bitch“ auf die Ohren, zu dem Udo seine Verachtung regelrecht ins Mikro würgt. Publikumsinteraktion ist nicht seine starke Seite, aber so kennen wir ihn – dafür gibt es permanent pittoreske Zusammenrottungen der Kombo am vorderen Bühnenrand. Da sehen wir gerne darüber hinweig, dass der Cheffe bisweilen den Überblick verliert („jetzt bin ich raus. Das waren so viele Alben, ich weiß grade nicht auf welchem dieses Lied war“), was ihn nur umso sympathischer macht. „Up To The Limit“ geht ordentlich nach vorne (und stammt von „Metal Heart“, man hilft ja gerne) und bringt auch den ersten „richtigen“ Crowdsurfer auf den Plan. „Sreaming For A Lovebite“ wirkt bewährt wie immer, bevor es dann – natürlich – die schaurige Mär vom Metallherzen, komplett mit Anleihen bei den Herren Tschaikowsky und Beethoven, auf die Lauscher gibt. Ein Schlachtross, das eben immer und überall funktioniert, auch wenn einige wohlwollende Zaungäste meinen, das sei Dirk Schneider, der vom „Fleischsalat“ singt. Wir singen dann auch gerne „Hei di hei do“ und freuen uns wie stets auf den Prototypen aller Speed Metal Songs, aber bei „Fast As A Shark“ schlägt dann die Stunde unseres Plauschs mit Sabaton, weshalb wir vom Tourmanager flugs hinter die Bühne geholt werden. „Balls To The Wall“ hören wir somit nur noch aus der Ferne. Dem Vernehmen nach war es gut. Im Dezember kommt er wieder nach München, quasi zum Weihnachtssingen am 21.12. – vielleicht spielt er da ja wieder sein Lied vom Eimer („I’m A Rebel“), das heute gefehlt hat. Wir werden dabei sein!
Powerwolf - zu den Bildern
Nach unserem Interview, bei dem mich Schlagwerker Roel van Helden auf dem Weg zur Toilette in voller Montur fast umrannte und die beiden Greywolf-Gitarristen schon in vollem Corpsepaint entspannt noch ein Getränk zu sich nahmen, eilen wir geschwind wieder vor die Bühne, wo ein schwarzer Vorhang das durchaus imposante Bühnenbild von Powerwolf verdeckt. Allerdings nicht allzu lange, den pünktlich um 20.30 erklingen die ersten Takte, der Vorhang wird weggezerrt und die Wölfe steigen mit „Blessed And Possessed“ in die "einzig wahre Metal Messe in Eurrrrropa" ein. Maximale Spielfreude, Pyro-Effekte allenthalben, ein wild umherhüpfender Falk Maria Schlegel (gleich an zwei Keyboards tätigt, wenn er nicht gerade den Animateur am Bühnenrand macht) und natürlich ein wie immer bestens aufgelegter Attila Dorn haben sich zu absoluten Stimmungsgaranten auf jeder Bühne gemausert. Dazu gehört natürlich die launige Art der Fronters, der immer wieder mal aus seinem augenzwinkernden Karpathen-Akzent fällt, aber meistens „vielen lieben Dankeschön meine Freunde“ ruft. „Guten Abend Fritzlar!“, begrüßt er uns frohgemut. „Ach verdammt, das war ja gestern! Heute sind wir in Kempten! Guten Abend Kempten!“ Wir amüsieren uns, viel wichtiger ist, dass es mit „Army Of The Night“ gleich ordentlich weiter nach vorne geht. Die Menge ist entzückt, darunter auch erstaunlich viele Kinder, die trotz ihres zarten Alters die Texte weitgehend fehlerfrei mit intonieren. Respekt!
Powerwolf - zu den Bildern
Die Hymne auf „das beste Stück“ des Mannes, „Coleus Sanctus“, läuft gut rein, bevor es bei „Amen And Attack“ wieder eine Pyro-Einlage nach der anderen setzt. Die Bühne macht gewaltig etwas her, mit wölfischem Backdrop und Falks Adler-Orgeln – man weiß eben, wie man sich wirkungsvoll inszeniert. Bei „Dead Boys Don’t Cry“ schwenkt Herr Schlegel eine gewaltige Fahne (auch wenn das Stück sicher nicht zu ihren großen Würfen gehört), und ich notiere erneut, dass man live ohne Basser auskommt. „Sacred And Wild“ feuert dann wieder wörtlich aus allen Rohren, bei „Aramta Strigoi“ ist der massive Publikums-Mitsing-Attacke gefragt, was das Publikum schon einmal vorab erledigt – „danke, aber ihr singt falsch! So wird das nix!“, korrigiert Herr Dorn. Beim episch-getragenen „Let There Be Night“ zeigt er sein ganzes eindrucksvolles vokalistisches Können und befragt uns dann erneut nach unseren private parts – „wer von Euch hat heute Morgen schon gezeltet?“, grinst der Kollege süffisant, bevor das lustige „Resurrection By Erection“ auch den letzten müden Krieger aufweckt. Ordnungsgemäßes gesangliches Massenvergnügen ist bei den „Hu! Ha!“-Chören bei „All We Need is Blood“ und auch der „Werewolves Of Armenia“ angesagt, Falk springt agil wie eh und je umher und wechselt permanent mit Attila die Seiten. „Seid ihr noch da?“, kommt nun eine doch eher rhetorische Frage. Heutzutage könne man so etwas ja kaum noch sagen, aber damit das klar ist: „wir explodieren für den Heavy Metal!“ So lassen wir uns das krachige „Sanctified With Dynamite“ auch politisch korrekt bestens gefallen, keine Frage. Dann ist diese wunderbare Sause auch schon wieder fast vorbei – wie jedes Wolfskonzert ging auch diese Ansetzung im Fluge vorüber. Herr Dorn bedankt sich noch für einen unvergesslichen Abend, sie kredenzen uns noch die Abrissbirne „We Drink Your Blood“ und lassen sich dann zu „Wolves Against The World“, die wieder aus der Konserve kommen, abfeiern. Vollkommen zu Recht. Wie immer ganz groß! Und nächstes Mal „Wolves Against The World“ bitte live spielen!
Sabaton - zu den Bildern
And now for the main event of the evening: den ganzen Festivaltag über konnte man schon die Requisiten am Bühnenrand erspähen, aber jetzt wird die Kulisse dann tatsächlich hergerichtet: man rollt den massiven Panzer herein, auf dem Hannes Van Dahls Schlagzeug thront, eine Videoleinwand wird aufgezogen, und die Mikroständer nebst Patronengürtel und Stahlhelm werden drapiert. Manch einem mag die Inszenierung nach wie vor als zu martialisch scheinen: die Optik passt schlichtweg zu den Themen, die Sabaton ohne Zweifel historisch akkurat recherchiert zum Vortrag bringen. Ein offenkundig wenig erfahrener Kollege im Fotograben fragt, ob denn hier auch so viele Pyros zu erwarten seien, worauf wir die Stirn runzeln und die Security antwortet: „Also, sagen wir mal so, auf der Setlist sind zwei Songs ohne Pyros…“ Die Präsenz von für den Einsatz gekleideter Feuerwehr ist enorm, man wird fast ein wenig nervös ob der kommenden Attacke. Vom Band läuft erst einmal ihre Coverversion des alten Reißers „In The Army Now“, dann flimmert das animierte Intro „The March To War“ bildgewaltig über den Schirm – und dann drischt Herr Van Dahl einen Trommelwirbel, Explosionen vernebeln alles, die Formation stürmt auf die Bühne und startet natürlich mit „Ghost Divison“ den bunten Reigen. Joakim springt als Hüpfflummi als letzter herbei, prügelt die Luft, braucht die gesamte Bühne als Wirkungsort und singt dabei noch wie eine Eins über die Panzer-Elite. Der Tarnhosen-Alarm ist durchgängig, die ganze Kombo – inklusive unserem Gesprächspartner, Bandgründer, Manager und Bassist Pär – schüttelt das Haupthaar, post was das Zeug hält und beweisen aufs Neue, dass Sabaton live eine Bank sind, die nie enttäuscht und nun „The Art Of War“ feurig abfeiert. Die Menge ist sogleich aus dem Häuschen, sofort kommen die ersten „Noch ein Bier“-Sprechchöre, aber nach der schmissigen Schottenhymne „Blood Of Bannockburn“ begrüßt uns Joakim erst einmal: „Guten Abend Bayern!“ Schön sei es hier, man habe Berge, gutes Wetter und Bier. Besonders spaßig sei der Empfang durch den Fanclub gewesen, der die Band am Vorabend zum Grillen lud und Herrn Broden dabei eine Speisekarte in die Hand drückte, die er nun gut gelaunt verliest: „Ok, even I know this is bad: gepresster Bärenhoden und schwedischer Elchpenis, naturbelassen.“ Nun, der Spaßfaktor ist eben immer gegeben hier, und nun muss er tatsächlich „noch ein Bier“ zu sich nehmen. Man habe heute einiges auf Lager, „some old shit, some unexpected shit, and some songs that are simply shit!“ Das lassen wir uns doch gleich gefallen, als mit “Attero Dominatus” in der Tat eine Nummer an die Reihe kommt, die lange nicht im Set war.
Sabaton - zu den Bildern
Jeder Song wird auf der riesigen Videoleinwand mit Plattencovern, Filmsequenzen oder Textzeilen passend untermalt, so dass wirklich jeder fröhlich mitsingen kann, was wir beim Titeltrack des aktuellen Albums „The Last Stand“ denn auch sehr gerne tun. Im Fotograben ist die Stimmung mittlerweile wieder entspannter, man sieht, dass wir es hier trotz aller Flammensäulen mit einem professionellen Ablauf zu tun haben, und freut sich an der energetischen Darbietung. Als nächstes kündigt Joakim erneut „old and unexpected shit“ an, was für das folgende „Panzerkampf“ durchaus zutrifft, was deutlich besser als auf Platte zündet. Aus dem Augenwinkel kann man derweil erhaschen, dass sich um das Festivalgelände ein Gewitter zusammenbraut – die Blitze sind schon deutlich zu erkennen. Wenn das hierher zieht, Freunde, ist diese Sause aber ganz schnell durch und wir saufen ab. Wir hoffen das Beste und werden belohnt: die Front zieht vorüber und verschont uns. Das Schicksal meint es eben gut mit dem Rock The King, das nun eine fulminante Inszenierung des Testosteron-Epos „Sparta“ erlebt, wieder mit „300“-inspirierten Videos. Als man erneut „Noch ein Bier“ fordert, macht Joakim den Fehler, diese Ehre dem jüngsten Bandmitglied Tommy zu überlassen, der den Inhalt des Bechers in Sekundenbruchteilen inhaliert. „You make me look like a pussy!“, stellt Herr Broden richtigerweise fest. Mit „Screaming Eagles“ steht nun eine pfeilschnelle Nummer von „Coat Of Arms“ auf dem Zettel, gefolgt vom wie immer herausragenden „Carolus Rex“. Die Menge stimmt nun unvermittelt die Chöre von „Swedish Pagans“ an, Tommy steigt instrumental kurz mit ein, aber Joakim protestiert: „This is not on the set list! This is not a democracy!“ Tommy gibt aber nicht nach, der Widerstand ist zwecklos – die Wikingerhyme muss gespielt werden. „I don’t like you anymore!“, grinst Joakim seinen Bandkollegen an, der ihm das eingebrockt hat, aber wir feiern die wunderbare Nummer gebührend. „Ok, if you think this is a democracy, then let’s vote: who wants to hear A Lifetime Of War? Or rather The Carolean’s Prayer? In English, or in Swedish?“
Sabaton - zu den Bildern
Per Open outcry-Verfahren optieren wir für die schwedische Variante der Lifetime of War, die ganz wunderbare Magie entfaltet, auch wenn das Mitsingen ein wenig schwerfällt. Smörebröd. Jetzt schnallt Joakim sich selbst die Gitarre um und sagt, er habe ja auf der ganzen Tour jede Menge Scherze damit getrieben, erst Smoke On The Water, dann Beat It angespielt, aber damit sei jetzt Schluss – muss auch nicht sein, wir nehmen das sehr gute „Resist And Bite“ auch ohne Klaumauk-Intro. „The Lost Batallion“ kommt mit vollem Intro bestens zur Geltung, die „Winged Hussars“ finde ich wie immer eher verzichtbar, aber die heftigen „Night Witches“ krachen dafür umso mehr. Kollektiver Stampf-, Sing- und Hüpfalarm dann natürlich bei der D-Day-Story „Primo Victoria“, die zum völligen Triumphzug gerät. Seit 18 Jahren sei man unterwegs, habe 1000 Shows in über 50 Ländern gespielt, aber Deutschland sei eben immer etwas speziell – immerhin habe man hier „the first sold out show outside of Sweden“ geschafft, erzählt Joakim. „There were 280 people, but it was sold out!“ Er liebe das deutsche Publikum, hasst es aber gleichzeitig: “Every time we come here, I get fatter because of all the beer! This is a metal concert, not a beer drinking show!” Nun denn, er verliert ein weiteres Duell gegen Tommy und stürzt sich deswegen lieber in die Samurai-Hymne “Shiroyama” (ich hätte wirklich fragen sollen, ob sie den deutschen Sprechgesangler namens Bushido kennen). Mit einem fulminanten „To Hell And Back“ ziehen sie nochmal alle Register, bevor der Feldzug hier und heute ein Ende findet.
Fazit: der Inbegriff eines überschaubaren, sympathischen Festivals, das in bester Erinnerung bleiben wird und 2018 hoffentlich in die nächste Runde geht. Dann mit Nightwish und Accept, nur so als Vorschlag…