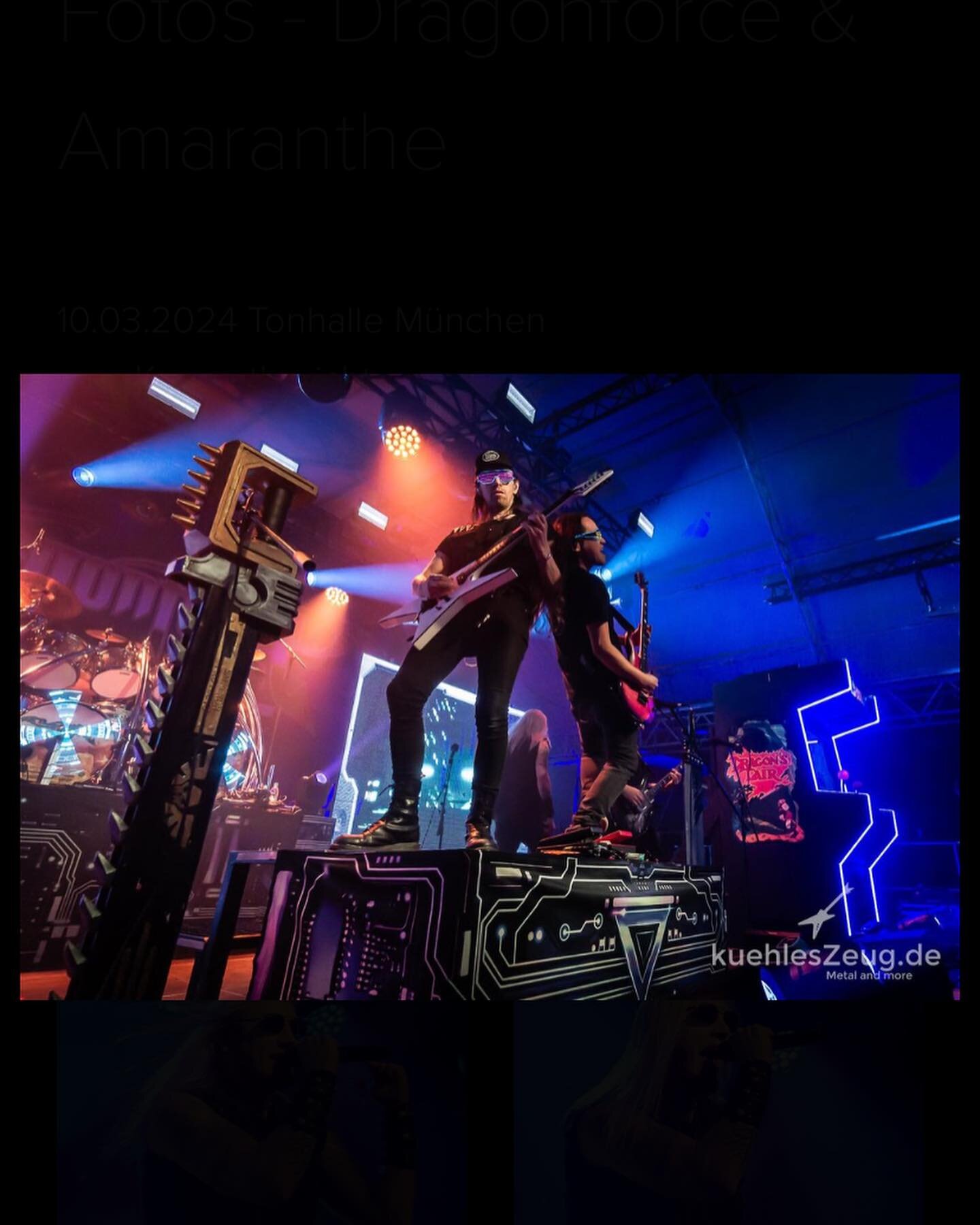Die heiligen sechs Könige: das Januar-Tasting
/Die sechs Könige...
Obzwar manch einer behauptet, Whisky sei ein Getränk für alle Jahreszeiten, passt das wärmende Wasser des Lebens zweifelsohne doch am besten zu eher rauen klimatischen Verhältnissen. Und nachdem sich wahrhaft klirrende Kälte in unseren Breiten angesagt hatte, konnten wir gar nicht anders, als uns erneut einer Auswahl feiner Tropfen zu widmen – zumal dieses Mal wirklich ausgesuchte Vertreter am Start waren.
Denn nicht drei (wie es dem Datum angemessen gewesen wäre), sondern gleich sechs royale Besucher gilt es zu entdecken am Vorabend des 06. Januar, an dem unsere südliche Heimstatt von Sturm, Schnee und arktischen -15 Grad beehrt wird. Den Frostriesen geben wir allerdings keine Chance und schreiten zu den Klängen der Kühles-Zeug-Playlist 2016 (in aller gebotenen Bescheidenheit schlicht „awesome songs“ genannt und hier demnächst zu bestaunen) umringt von einem ausführlichen Arrangement aus Christstollen (muss weg) und Hebridean Sea Salt Caramel Fudge (muss sein) gleich zum ersten Vertreter, der uns sofort in seinen Bann schlägt.
Seit Jahrzehnten nach wie vor familiengeführt, eröffnet der Glenfarclas 15 den Reigen der höherwertigeren Whiskys mit dieser Variante zu einem gewohnt hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Mit seinen 46% kommt der 15jährige in einer dunkelbraunen Flasche daher und setzt sich so schon von seinen jüngeren Kollegen aus gleichem Hause ab. Auch im Glas steht der Tropfen dann ausgesprochen dunkel, nach der für alles brauchbaren Klassifizierung als „Bernstein!“ kommen wir überein, dass dies eher einer Messingfärbung nahe kommt, die Spenglermeister Sebbes an Fallrohre erinnert (und dieses Wort verdient es öfter genutzt zu werden, zweifelsohne). Verantwortlich dafür zeichnet die Nachreifung des Brands in first fill Oloroso Sherry-Fässern, was wir nach einem feinen Korken-Schlupp sofort auch in der Nase spüren. Die ausladenden Sherry-Aromen sind unverkennbar, auch wenn einzelne Tester sich hier standhaft weigern, diese Note als solche zu charakterisieren, und auf Butterkeksen, Zwetschgen und Himbeeren bestehen. Mild kommt er in jedem Fall daher, vollmundig, mit viel Frucht und im Hintergrund karamelligen Eichenfass-Reminiszenzen – „wie Werther’s Echte!“, ruft der eine oder andere aus. Im Geschmack setzt sich diese volle Weichheit fort, wir fühlen uns als dunkle Früchte und Beeren erinnert, Biscuit machen wir aus, bevor eine nicht unangenehme Schärfe eintritt und ölig verweilt. Im Abgang hält sich der Glenfarclas ausgesprochen lange, mit Noten von Lebkuchen und Eichenfass. Strahlende Gesichter allenthalben: vollmundig, süffig, auf angenehmste Weise komplex und lohnend. Im Vergleich zu den 10- und 12jährigen Varianten spielt dieser Vertreter seines Hauses in einer gänzlich anderen Liga und reißt uns zu Verzückung hin – und dem einen oder anderen kleinen Nachschenker.
Piratentrunk
Weiter geht die Reise mit dem Balvenie 14 Caribbean Cask, den ich ja schon während unserer Getränkereise 2016 direkt vor Ort verkosten konnte. Als Schwesterdistillerie von Glenfiddich-Gründer John Grant erbaut (vermutlich ebenso eigenhändig mit Hilfe seiner 3-8 Kinder), nennt Balvenie als eine der wenigen Brennereien eine hauseigene Böttcherei (also eine Fasswerkstatt) ihr eigen, wo der legendäre Whisky Master David Stewart (mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand) auch noch die Fässer für diese Variante des Balvenie befüllte, die anstelle des üblichen Sherry-finish in Rumfässern nachreift. Vor Ort erläuterte uns Charles Metcalfe letztes Jahr, dass dies nicht nur künstlerisch-kreative, sondern auch durchaus handfeste Gründe hat: durch den sinkenden Konsum steigen die Preise für Sherry-Fässer permanent, weshalb man zunehmend auf Alternativen wie Rotwein oder eben Rum ausweicht. Der Jack Sparrow-Aspirant, mit dem wir es hier und heute zu tun haben, bringt 43% auf die Messwaage und steht ebenso fallrohr-getönt im Glas, wobei man hier durch Färbung etwas nachgeholfen hat. Schon im Geruch schlägt die Rum-Note durch, mit Anklängen an Zucker (was hier ja kaum verwunderlich ist), Früchte (Apfel) und im zweiten Schritt dann auch Vanille-Aromen.
Balvenie im Glas
„Das riecht wie ein Rumtopf!“, fasst Fernsehkoch Sebbes den Eindruck treffend zusammen – in der Tat vermeint man, eingelegte Zwetschgen oder ähnliches vor sich zu haben. Im Geschmack hält der Balvenie dann leider nicht das, was der erste Eindruck verspricht: mild ist er zweifelsohne, angenehm ölig, aber weitgehend flach und ohne großen Charakter fällt er gegen den Glenfarclas doch deutlich ab. Im sehr kurzen Abgang tritt die Rum-Note dann stark hervor und gesellt sich zu einem Hauch Vanille – aber so richtig von der gepolsterten Bank kann uns dieser Kollege nicht schubsen. Da sind wir aus dem Hause Balvenie durchaus beeindruckendere Vertreter gewohnt, aber ausgesprochene Freunde des Zuckerdestillats mögen dies eventuell anders beurteilen – vielleicht mag Gastschreiber und Rum-Afficionado Dagger ja mal einen Blick wagen.
Nach einer kurzen Pause für Wasser (reinigt das Glas), Kaffeebohnenschnuppern (setzt die Nase auf neutral, funktioniert echt!) und Fudge (schmeckt gut) treiben wir nun erst einmal Gälisch-Studien: Cù Bòcan steht auf der nächsten Flasche nämlich zu lesen, und wir erfahren gerne, dass dies auf die gälische Legende eines Geisterhundes diesen Namens zurückgeht, der bei Nebel auf den Mooren aufzutauchen und in einem blauen Nebel zu verschwinden pflegt. Das haben wir heute zwar nicht vor, aber dennoch neigen wir uns dieser Spezialvariante der Brennerei Tomatin gerne zu, deren transparente Flasche durch eine stilisierte Darstellung des Dämonenhundes geziert wird. Auch hier erwartet uns wieder eine sherry-cask-Reifung, was an der sehr dunklen Farbe deutlich zu sehen ist – und auch die Nase kommt (kaffeebohnen-neutralisiert) auf ihre Kosten: sehr fruchtig, nun auch für alle eindeutig Sherry-getränkt, mit deutlichen Hinweisen dunkle Schokolade und süßen Rauch („wie Schwarzwälder Schinken!“) steigt uns der Duft entgegen. Im Geschmack schmeicheln uns die 46% ebenfalls mit schokoladigen Noten und Schinken-Anklängen, bevor im Abgang ganz kurz noch der Rauch um die Ecke schaut. Auch angesichts der fehlenden Altersangabe eine reife Leistung, die rundum zu gefallen vermag.
Bowmore VS. Bowmore
Nach unseren linguistischen Ausflügen wechseln wir nun nicht nur vom schottischen Hochland auf die Inseln (genauer gesagt Islay), sondern auch gleich die wissenschaftliche Disziplin und versuchen uns in Komparatistik: wir vergleichen zwei unterschiedliche Vertreter der gleichen Brennerei und legen in einer Querverkostung gespannt eine Bowmore-Ausgabe des unabhängigen Abfüllers Berrys neben den 15jährigen Bowmore Darkest. Für seine Abfüllung schnappte sich Berry im Jahr 2013 diverse Fässer mit Destillaten von 2001, so dass wir hier nun einen 11jährigen Single Cask-Bowmore bestaunen dürfen, der 46% mitbringt. Ungefärbt steht er im Glas, deutlich heller als unsere bisherigen Versuchsobjekte, wie Zitronensaft und verströmt einen wunderbar sanften Geruch nach Vanille und Rauch gleichermaßen, nach Keksen nach eben dem Fudge, den wir ja als Vergleich bestens heranziehen können. Wenig alkoholisch nimmt er sich aus, erinnert den einen oder anderen an Lutschdrops – und im Geschmack entfaltet sich ein ungemein mild-samtiges Erlebnis wie von einem Vanillepudding, was langsam aber stetig sanften aber bestimmten Rauch-, Speck- und Gewürznoten Platz macht. „Phänomenal!“, konstatiert Begeisterungsfähigkeitscoach Sebbo und schiebt nach, das Ganze gemahne ihn wohlig an rohen Plätzchenteig mit Zitronen-Elementen.
Die Bowmores nebeneinander - Welches ist wohl der Darkest?
Wie dem auch sei, diese Abfüllung überzeugt auf der ganzen Linie und steht schon farblich in starkem Kontrast zum heutigen Kontrahenten: der Bowmore Darkest trägt seine Bezeichnung nicht umsonst. Die drei Jahre Nachreifung in Oloroso-Sherryfässern sieht man ihm untrüglich an, in einem sehr dunklen Braunton steht er im Glas, den wir einfach nur als „krassem Farbe!“ beschreiben können. In die Nase steigt dieser Bowmore dann mit schönem Aroma von Zimt, Schokolade (Muffins werden ebenso ausgemacht) und getrockneten Früchten, vor allem Rosinen (in anderen Worten verhunzten Trauben, aber das ist mein persönliches Thema). Auf der Zunge nimmt sich der Bowmore dann zunächst aus wie eine gefüllte dunkle Praline, mit wunderbaren Schokoladen-Noten, die dann allerdings einem süß-speckigen Rauch weichen, wie wir das von Bowmore ja gewohnt sind. Wunderbar balanciert hält sich dieser Eindruck, im Abgang noch ergänzt noch Anklängen an Kaffee und Bitterschokolade. Einen direkten Sieger vermögen wir in dieser Ausscheidung somit nicht zu küren: wir notieren Zustimmung für beide Varianten und sind erstaunt, wie breit die Variation einer einzigen Brennerei doch sein kann.
ohooohooohooo der König des (Weih-)Rauchs
Nun gilt es ein wenig innezuhalten, wir frönen noch einmal der Playlist und dem Wasser, denn nun steht das Hochlicht des Abends bevor – zweifelsohne zumindest in preislicher Hinsicht. Denn den hervorragenden Ruf ihres Octomore lässt sich die Bruichladdich-Brennerei mit durchaus anspruchsvoller Preisstellung entlohnen. Wir nähern uns dem Objekt der Begierde schrittweise: „the most heavily peated malt“ überhaupt haben wir bekanntlich vor uns, 208 ppm wirft er ins Reagenzglas – also 208 Rauchpartikelteile einer Million, welche Million (Lego? Luft? oder was?) vermag man mir allerdings nicht zu beantworten. Sei’s drum, man bemüht sich auch optisch um Akzente und setzt auf modernistische Züge: ganz in schwarz kommt die stylish geschwungene Flasche daher, mit roter Aufschrift und dem Zusatz „7.2“ – das wirkt fast schon wie eine Software-Version, ob man die Flasche nach Leerung allerdings per Bluetooth updaten und wieder füllen kann, bezweifeln wir. Vergleichsweise wenig Zeit verbringt er im Fass, ganze 5 Jahre Reifung stehen zu Buche, und nach einem fast schon feierlichen Schlupp konstatieren wir, dass die ganz große Rauchattacke erst einmal ausbleibt. Da hatten wir schon durchaus rabiatere Gesellen am Start (man denke nur an den doch eher ruppigen Smokehead), hier notieren wir fast schon sirupartige Süße mit Honig-Elementen, in Zucker eingelegte Früchte erkennt man da, bevor sich dann doch die Schwere des Rauchs in Speckaromen bemerkbar macht. Im Glas steht der Octomore dann vergleichsweise hell (er ist eben noch jung an Jahren), und nach einer respektvollen Pause riskieren wir es dann. Wie zäher Honig wirkt das, mit mächtigem Antritt kommt er zäh und ölig daher, wir denken an Zuckerrüben, an Gummibärchen, an so einiges, und vor allem daran, dass wir hier eine Abfüllung in cask strength mit über 58% vor uns haben, die wir sogleich durch einen Tropfen Wasser verdünnen. Siehe da, so gezähmt, entfaltet der Octomore ein deutlich breiteres Spektrum von Vanille und Räucherschinken. Wir schauen uns einigermaßen sprachlos an – ein komplexer, wuchtiger, massiver Vertreter, der in jedem Fall etwas ganz Besonderes liefert, nicht zu vergessen den schier endlosen Abgang, den Graphiker Sebbo in einer langen Linie versucht optisch einzufangen. Wir bescheinigen den Damen und Herren aus dem Hause Bruichladdich, hier wahrlich ganze Arbeit geleistet zu haben, und fragen uns, wie der Octomore wirkt, wenn man nicht vorher schon eine kleine Auswahl hinter sich gebracht hat.
Wie immer ... Konzentriert bei der Arbeit
Bevor ich mich wieder in die eisige Nacht stürze, lassen wir den Glenfarclas nochmals antreten und stellen fest, dass dieser Kollege sich auch nach dieser Geschmacksexplosion immer noch bestens behaupten kann. Somit trägt der Glenfarclas 15 eindeutig den Sieg auf der Preis-/Leistungsseite davon, während die anderen Vertreter – mit kleinen Abstrichen bei unserem karibischen Freund – allesamt in ihrer Kategorie vollauf zu überzeugen wissen. Und jetzt können die drei Könige gleich zweimal vorbeischauen. Einen Dram hätten wir in jedem Fall für alle.