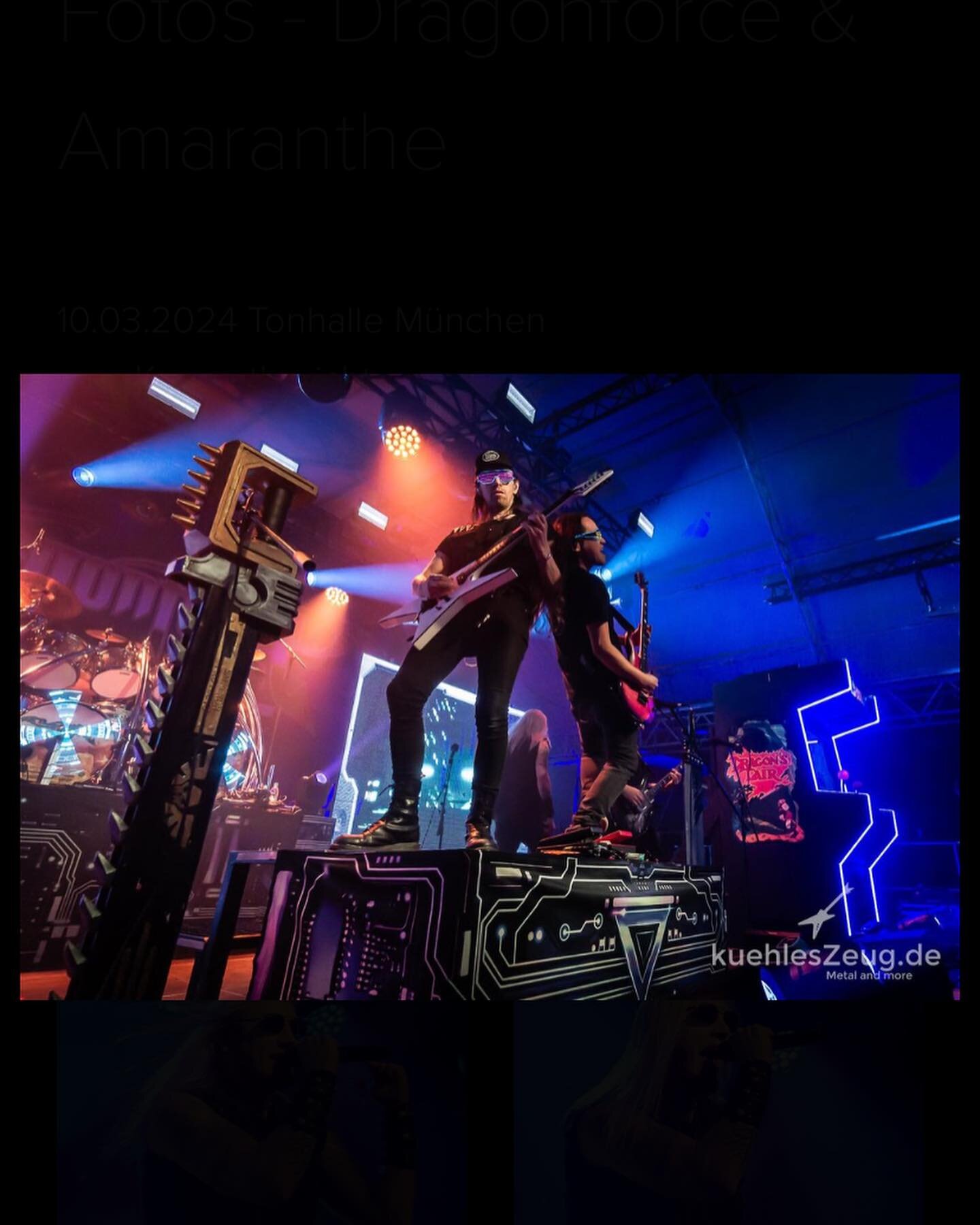Melodien der Saison, Wolkenbrüche und Ballstafetten: Metallica übernehmen München
/24.05/26.05 2024 Olympiastadion München
Two Nights – No Repeats! Unter diesem magischen Motto rollt ein monumentaler Tross um den Globus, mit dem Metallica unter der Flagge „M72“ ihr aktuelles Werk und mehr oder weniger ihr gesamtes Schaffen auf die Welt loslassen. Zwei vollkommen unterschiedliche Sets, zwei Abende, und dazu noch vor der Haustüre – da können wir gar nicht anders, oder?
In Abwandlung eines Werbespruchs der 70er Jahre wollen wir zunächst für den Freitag feststellen: nie waren wir so nass wie heute. Man schlidderte ab 22 Uhr sicherlich haarscharf am Abbruch vorbei, beeindruckende Handy-Videos zeigen später Blitzeinschläge im Zeltdach – quasi ein reales Ride The Lightning. Umso erstaunlicher, dass die Four Horsemen (im Gegensatz zu ihrem Haus- und Hoffotograf Ross Halfin, der nach eigenem Bekunden das Feld räumte) unverzagt das Set zu Ende bringen. Respekt. Aber wir greifen vor.
72 Seasons – diese, in knalligem gelb gehaltene Doppelscheibe, die 2023 das Licht der Welt erblickte, zeigt Metallica so komplex (bisweilen zu verkopft), aber auch so heavy, wie das eben sein muss und seit „Death Magnetic“ und vor allem „Hardwired to Self Destruct“ endlich wieder der Fall ist. Schon die Vorankündigung der Veröffentlichung sorgte für allerlei Aufhebens in Hobbiton, wurde doch eine begleitende Tour avisiert, die an jedem Austragungsort zwei volle Konzerte mit unterschiedlichen Sets kredenzen sollte. 2023 gastierte man dabei hierzulande nur in Hamburg, 2024 stand dann die bajuwarische Landeshauptstadt auf dem Plan – was zur kuriosen Wendung führte, dass man sich ganze 1,5 Jahre vor dem Event schon Tickets sicherte. Natürlich. Man will ja nicht so knapp dran sein.
Während kurzzeitig angesagte Kinderbands spaßige Dinge wie „Instagram Takeovers“ veranstalten, machen Metallica gewohnt Ernst: den spielfreien Samstag nutzt man in der Alten Messehalle auf der Theresienhöhe (kennen wir bestens von der Comicmesse) für die Vorstellung von Ross Halfins Bildband, wo sich auch Kirk und Rob blicken lassen, es gibt Pop Up Stores, und vor allem am Samstag schwärmen in den öffentlichen Parks der Stadt vor allem schwarz gewandete Gestalten, der Ziel recht eindeutig ist. Metallica takes München – für ein Wochenende, das lassen wir uns doch gefallen.
Damit wir die Chose nicht von allzu weit weg verfolgen müssen, bewegen wir uns standesgemäß früh in Richtung Olympiastadion, wo uns am Freitag das Schlangesteh-Glück hold ist: wir schaffen es tatsächlich, in die quasi-Front of Stage-Area zu gelangen, wo 8.000 Schlachtenbummler ein Bändchen erhaschen und somit mehr oder weniger genauso nah am Geschehen sind wie die Fraktion, die sich im preislich anspruchsvollen „Snakepit“ genau in der Mitte tummelt. Wie schon bei den Hardwired-Hallenkonzerten ist das Bühnenarrangement nämlich extravagant und sehr sympathisch: die Mitte des Stadions wird von einer gewaltigen runden Laufbahn eingenommen, die an eine Carrera-Bahn erinnert, oben schweben ebenfalls im Rund kegelförmige Leinwände – richtig schlechte Sicht gibt es nicht, man ist nur eben nah oder etwas weiter entfernt. Nachdem damit wirklich auch der letzte Platz verkauft werden kann, füllen an den beiden Tagen jeweils beeindruckende 70.000 Anhänger das Stadion – rekordverdächtig. Am Sonntag rücken wir zwar zur gleichen Zeit an, nachdem aber an Tag 2 alle ja irgendwo schon in der Stadt sind und sich die Bändchen-Geschichte herumgesprochen hat, gilt das Motto: wir müssen draußen bleiben. Macht aber nichts, eine ausnehmend zuvorkommende Security-Dame an der Absperrung sorgt für treffliche Unterhaltung, leiht mir einen Stift für das unvermeidliche Kreuzworträtsel und verteilt bereitwillig Wasser. Großes Kino!
Ach ja, Vorgruppen gibt es auch, jeweils um 6 Uhr geht das Geschehen auf die Reise – am Freitag darf ein gewisser Wolfgang van Halen die Feierlichkeit eröffnen. Der stattlich gebaute Eddie-Filius gibt mit seiner Kombo Mammoth durchaus brauchbaren, melodischen Hard Rock, macht auch am Mikro eine passable Figur und streut gerne auch mal die Finger Tapping-Technik ein, die der Herr Papa einführte und zur Perfektion brachte. Ordentliche 30 Minuten! Was man für die Folgezeit nicht sagen kann: die englischen Metalcore-Jünger Architects rühren eine krude Mischung aus Linkin Park und Five Finger Death Punch an, die Songs bestehen genretypisch aus schweren Rhythmen, dem obligatorischen Eröffnungs-Gekreische und einer Prise Melodie, die leider viel zu oft untergeht. Auch wenn Shouter Sam Carter versucht, mit einem deutschen Fußball-Shirt zu punkten (für einen Briten durchaus bemerkenswert) – das war nix. Nur marginal besser geht es am Sonntag mit Ice Nine Kills weiter: die US-Metalcore-Gesellen veranstalten ab dem Auftakt „We are Savages“ in Anzug, Horrormasken und allerlei Zubehör eine Art Alice Cooper-Muppet-Show, die Lordi deutlich besser draufhaben, auch wenn Zombies à la Resident Evil oder ein Leatherface-Motorsägenschwinger mit am Start sind. Auch wenn es mit einem feschen Freddie Kruger-Handschuh und einem durchaus zündenden „A Grave Mistake“ gute Momente gibt: Haken dran. Aufwärts geht es dann endlich buchstäblich mit Five Finger Death Punch: mit „Lift Me Up“ steigen die Amis in ihr energetisches Set ein, das vormacht, wie man kraftvolle Härte mit ordentlichen Melodien kombiniert. Sänger Ivan Moody zeigt sich dabei gar nicht launisch, sondern bestens aufgelegt, scheint entzückt ob der Menge und der Resonanz auf seine Kombo („I missed you!“, ruft er uns zu), die mit „Wash It All Away“ gleich das nächste Geschoss abfeuert. Zoltán Báthory biegt die Saiten gewohnt virtuos, Basser Chris Kael schwingt den Piraten-Rauschebart – man ist eben Rock am Ring-erfahren. Geht doch! Auch der Sin City-Soundtrack-Beitrag „House of the Rising Sun“ zündet ordentlich, bevor man dann zwei treue Schlachtenbummler auf die Bühne holt, die den inneren Zirkel abklatschen dürfen. „The Wrong Side Of Heaven“ funktioniert ebenfalls bestens, wir sind versöhnt – andere Ansetzungen der Tour haben mit Vorbands wie Epica vielleicht noch mehr Glück, aber man will ja nicht so sein.
Jeweils weitgehend pünktlich um 20:30 geht dann ein Raunen durch die Menge, die Hauptattraktion des Abends marschiert durch auf weitgehend frei einsehbarer Bahn in Richtung Bühne, wo man erst einmal ein schmackiges „It’s A Long Way To The Top“ einspielt (passt irgendwie, das hören wir an gleicher Stelle ja vielleicht in ein paar Wochen, wenn Agnus und seine verbleibenden Kumpane zu uns kommen). Die Videoleinwände zeigen dann, wie man das kennt, Clint Eastwood, der eine Kanone auf Eli Wallach abfeuert, der auf einem Friedhof umherirrt – wie schon lange gehabt eröffnet „The Ecstasy of Gold“ von Ennio Morricone (aus dem Soundtrack von The Good, The Bad and The Ugly) das Set, während die Herren weitgehend entspannt auf die Rennstrecke gehen. Ganz zum Schluss schwebt ein knallgelbes Schlagzeug empor, man hätte schon denken können, Lars sei daheim geblieben, aber dem ist natürlich nicht so – ganz im Gegenteil drischt unser Lieblings-Däne massiv in die Felle, als man jeweils mit einem massiven Thrasher einsteigt: nicht anders als mit dem legendären „Whiplash“ geht es am Freitag los, das Stadion steht sofort Kopf, was dann am Sonntag mit dem ebenso knalligen Opener „Creeping Death“ keinen Deut anders ist. Wir können uns kaum wundern, wie dieser doch durchaus extreme Sound, der unsere Kollegstufen-Kollegen Ende der 80er zur Weißglut trieb, diese Massen mobilisiert – Schlag auf Schlag geht es mit „For Whom the Bell Tolls“, „Of Wolf and Man“ (Freitag) sowie „Harvester Of Sorrow“ und dem „first song Lars and I put together“, dem brachial-unterhaltenden „Hit The Lights“ (Sonntag) weiter. Was ein Auftakt! Man hat kaum Zeit, die Protagonisten zu bestaunen: Kirk führt mit wallenden Locken und Glitzerjäckchen seine Auswahl an thematisch treffend mit Filmmotiven verzierten Sportguitarren vor („The Mummy“ mit Boris Karloff und „White Zombie“ mit Bela Lugosi sind beide wieder am Start), Rob trägt das Haar wahlweise in Zöpfchen (Freitag) oder offen (Sonntag), malträtiert den schreiend gelben Bass („that’s a nice bass you have there“, lobt James) mit gewohnter Präzision und lässt das Instrument um sich kreisen – den früher üblichen Watschelgang hat er wohl endgültig abgelegt. Ist ja auch anstrengend. Zeremonienmeister Papa Hetfield hat offenbar die Eskapaden-Zeit überwunden und macht einen frischen, gut gelaunten Eindruck: in Biker-Joppe oder dann auch in schicker Schlangenlederoptik, begrüßt er uns jeweils ehrlich beeindruckt. „We are happy to be here, and we are happy that you are here! Thank you for coming back!”.
Der Sound drückt massiv, vor allem der Bass donnert ehrfurchtgebietend. Die Saitenfraktion wandert permanent das schier endlose Rund entlang, klatscht im Snakepit ab und achtet akribisch darauf, dass wirklich aus jedem Blickwinkel immer etwas zu entdecken ist. Schön! Zum folgenden “The Memory Remains” singen wir am Freitag beherzt mit, am Sonntag folgt an dieser Stelle ein monumentales „Ride the Lightning“, mit Tempowechseln und flirrend-melodischem Soloteilen immer noch einer meiner Favoriten, bei dem die Videoleinwände in Blau getaucht das Blitzinferno nachahmt, das uns zwei Tage zuvor fast in real ereilt hätte. Nach diesem ersten Viertel folgt der erste Überraschungsmoment: das Schlagzeug versinkt wieder im Bühnenboden und taucht auf der gegenüberliegenden Seite wieder auf – so kommt im Verlauf des Abends jeder in den Genuss, dem alten Dänen Lars bei der Arbeit zuzuschauen (und dabei festzustellen, dass er mittlerweile ein recht dürres Männlein mit Kappe geworden ist, über dessen Schlagkraft man nur noch staunen kann).
In Runde 2 ballert am Freitag der Hochgeschwindigkeitszug „Lux Aeterna“ massiv ins Kontor – „Full speed or nothing!“, und wenn wir uns gefragt haben, was denn die reichlich deplatzierten „Private Platforms“ sind, auf denen in zwei Klappstuhlreihen irgendwelche Günstlinge sitzen: das war wohl die Lux Aeterna-Experience, schlappe 7000 Dollar pro Nase für zwei Abende. Dafür kann man dann beruhigt den Klappstuhl ausgraben. Na, wer’s braucht. Am Sonntag gibt’s an dieser Stelle den langen, ebenfalls nicht gerade langsamen Titeltrack des neuen Albums, der allseits bekannt scheint und bestens ankommt. Mit „Too Far Gone“ und „If Darkness Had A Son” kommen weitere Stücke vom neuen Werk zum Vortrag, bevor Kirk und Rob jeweils zu einem kurzen Zwischenspiel ansetzen. Freitags geben sie mit dem „Hofbräuhaus Folk Jam“ ein etwas wirres Instrumental zum Besten, Sonntags versucht man sich dann witzigerweise wieder an deutschem Liedgut – es dauert eine Weile, bis man beim radebrechenden Rob die „Rosamunde“ erkennt. Lustig allemal, und ein Schelm, war dabei denkt, dass man sich damit auch wieder eine kleine Verschnaufpause für den Rest der Kombo erkauft. Nun können wir dann den vollen Vorzug des Konzeptes zweiter Konzerte erleben: wir müssen uns nicht zwischen den beiden epischen Halbballaden entscheiden, nein, ganz einfach: sowohl „Fade To Black“ („this song is so old, but still so good“, urteilt James – richtig!) als auch „Welcome Home (Sanitarium)“ kommen an dieser Stelle zum Zuge, und vor allem letzteres Stück liefert eines der Highlights der beiden Abende. Massiv! Nach den jeweils neuen „Shadows Follow“ und „Inamorata“ (nach den Worten von James sein Favorit vom neuen Album – live noch nie gespielt, etwas zu lang, aber durchaus anspruchsvoll) schlägt dann die Stunde der Instrumentals. Das Schlagzeug wandert dafür wieder eine Position weiter, mittlerweile nimmt Lars auf der Haupteinlass-Seite Platz, und mit einem gefühlvollen „This is for Cliff!“ huldigen sie mit „Orion“ und dem düster-drohenden „Call of Cthulhu“ ihrem viel zu früh verstorbenen Bassisten, der mit diesen Stücken bekanntlich die komplex-klassisch angehauchten Elemente in den Thrash-Sound der frühen Metallica einbrachte. James schwingt dabei eine ordentliche Motiv-Gitarre mit dem Konterfei von Lovecrafts Lieblings-Schlabbermonster, wir freuen uns einstweilen, dass das ewig totgenudelte „Nothing Else Matters“ live nach wie vor seine ganz eigene Magie entfaltet (wobei wir dem Urteil eines Umstehenden, „ja, dafür samma da, ned für den andern Schmarrn“ so aber ganz und gar nicht folgen wollen), während am Sonntag an dieser Stelle das ebenfalls bedächtige „No Leaf Clover“ (mit James auf einem Barhocker) die irgendwie auch mal dagewesene Load/Reload-Phase in Erinnerung ruft. „Do you like heavy?“ donnert uns James nun entgegen, aber sicher doch – „Metallica gives you heavy!“, so kündigt der Papa ein in der Tat walzendes “Sad But True“ vom schwarzen Album an, das am Sonntag von „Wherever I May Roam“ repräsentiert wird. Damit ist die MTV-Ära denn auch (fast) erledigt, eines fehlt noch und kommt dann am Ende natürlich auch.
Am Freitag allerdings zeigt sich jetzt erst einmal, dass eine harmlose Bemerkung durchaus Folgen haben kann: „Du, irgendwie tröpfelt es“, stellt mein Mitstreiter fest, und fast kommt man sich vor wie in Young Frankenstein, wo das Faktorum Igor feststellt: „Could be worse – could be raining“, worauf sich eine Sintflut entlädt. Die trifft uns nämlich jetzt auch, so ziemlich genau gegen 22 Uhr fängt es an zu regnen, dann zu prasseln und dann zu schütten, schön garniert mit optisch beeindruckenden, aber auch ein wenig furchteinflößender Lightshow in Form von Blitzen. In kürzester Zeit sind wir zu „The Day That Never Comes“ alle, die Herrschaften auf der Bühne inklusive, komplett durchnässt, vom Schlagzeug fliegt das Wasser in Fontänen hoch, und man muss sich wundern, dass die Stromgitarren nicht den Geist aufgeben. James versucht sich in Humor („it’s just water“), aber lustig ist anders. Als man ihm nach einigen Minuten eine Jacke reicht, sagt er nur noch lakonisch: “Well, it’s a little late for this now.” Dennoch – die Sause läuft weiter, und bei einem brachialen „Hardwired to Self Destruct“ bricht dann hinter uns ein veritabler Moshpit los. Was wir sogar gut finden. Irgendwie passt das heute. Wir rammeln gut gelaunt im Rahmen unseres Vermögens mit. Kurze Blende zum Sonntag: „we ordered some clear skies“, hatte James da ganz am Anfang gesagt, und an Tag 2 klappt das tatsächlich. Schön dann die Szene, als ein kleiner Pimpf (offenbar im Snakepit) per Pappedeckelschild darum bittet, er möge Drumsticks mit Lars tauschen, das sogar gesehen wird, der junge Mann tatsächlich auf der Bühne landet, ein paar Takte auf dem gelben Drumset hämmern und danach noch einen ganzen Song zuschauen darf. So geht Fannähe! Larrrrrs – guter Mann. Zurück in die Regenschlacht vom Freitag: das Rammel-Spektakel geht mit einem mächtigen „Fuel“ in die nächste Runde, irgendwie hat man sich an die Ströme von oben gewöhnt (nur Kirk sieht nicht so ganz happy aus mit der Feuchtigkeitslage), auch wenn das Trommeln auf dem Kopf stetig zuzunehmen scheint. Und jetzt packen sie dann die ganz große Partykelle aus: zu dem nun folgenden unverwüstlichen Song aus den Anfangstagen (mit dem feschen Auftgalopp “Scanning the scene here in Munich tonight”) fallen hunderte riesiger, gelb-schwarzer M72-Bälle aus den Boxentürmen und werden wie beim Wasserball frohgemut durch die Gegend geschlagen, wobei manch einer versucht, die Luft entweichen zu lassen und das Ding einzupacken, was nicht allzu leicht ist. Dabei kommt es dann zum üblichen Missverständnis im Songtext: während die Menge beherzt, aber natürlich falsch „Seek And Destroy“ intoniert, gibt uns James doch eigentlich seit Jahren vielmehr bekannt, dass er auf der Suche nach zwei Zauberern aus Las Vegas ist: „Searching Siegfried And Roy!“, so weiß man das doch als Kenner. Wir helfen ja gerne aus. Am Sonntag spielen wir etwas später im Bällebad, dort bestaunen wir zunächst noch das brachiale „Moth Into Flame“ – wieder ohne Drohnen und leider ohne die bei den MTV Music Awards erstaunlich kongeniale Lady Gaga, aber immer noch mit umwerfender Energie und vor allem ordentlichen Pyro-Effekten fast schon wie beim Pokalfinale am Abend vorher. Und weil das mit dem „heavy“ anscheinend noch nicht genug war, ballern sie uns mit „Fight Fire With Fire“ einen der aggressivsten Brocken um die Ohren, den sie im Programm haben – puh. An die Position des obligatorischen Covers tritt nun der alte Rocker „Breadfan“, eigentlich von den Proto-Proggern Budgie, den man seit der Justice for All Tour immer wieder mal aufbietet. Dazu amüsieren wir uns über Kirks schwarzes T-Shirt mit der schlichten Aufschrift „Everything is fucked“ – das klingt eher lakonisch und damit schon wieder spaßig. Sonntags biegen wir dann mit der Antikriegssemiballade „One“ auf die Zielgerade ein, komplett mit Knalleffekten und beklemmenden Szenen auf den Videoleinwänden. Freitags kämpfen wir weiter wacker die Wasserschlacht, James informiert uns „we will not stop, we will play one more“, was sie dann einem grandiosen, aber verregneten „Master of Puppets“ auch tun – der Job, den am Sonntag natürlich „Enter Sandman“ übernimmt, das die ganze Sache zu einem grandiosen Abschluss bringt. Jeder darf nun nochmal etwas sagen, reihum geht das Mikro – „thank you for my first shower in the week!“, witzelt James, „Muuuuunchen“, bedankt sich Rob – den man unweit von uns gerne als „Robäääääärt“ ruft, sehr gelungen, übernehmen wir gerne, und Lars stellt fest: „Thanks for this once on a lifetime experience. In Lyon, 10 years ago, it rained so hard and I swore I’d never take off my shirt again. Well, I did tonight”. Hat uns etwas gefehlt in diesem monumentalen Aufgebot? Die alte Granate „Battery“ vielleicht, oder der „Phantom Lord“, aber das sind Petitessen. Großes Metall-Tennis. Der Abmarsch am Freitag gestaltet sich abenteuerlich über gewaltige Wasserlachen, die öffentlichen Verkehrsmittel fahren eher erratisch, sonntags geht das besser dank eigenem Transport. Wir fassen zusammen: ein Kraftakt für alle Beteiligten. Aber eine Sternstunde. Wir sind, so hat James uns ja informiert, alle gerne aufgenommen in die Metallica Family. Dann soll das wohl so sein.