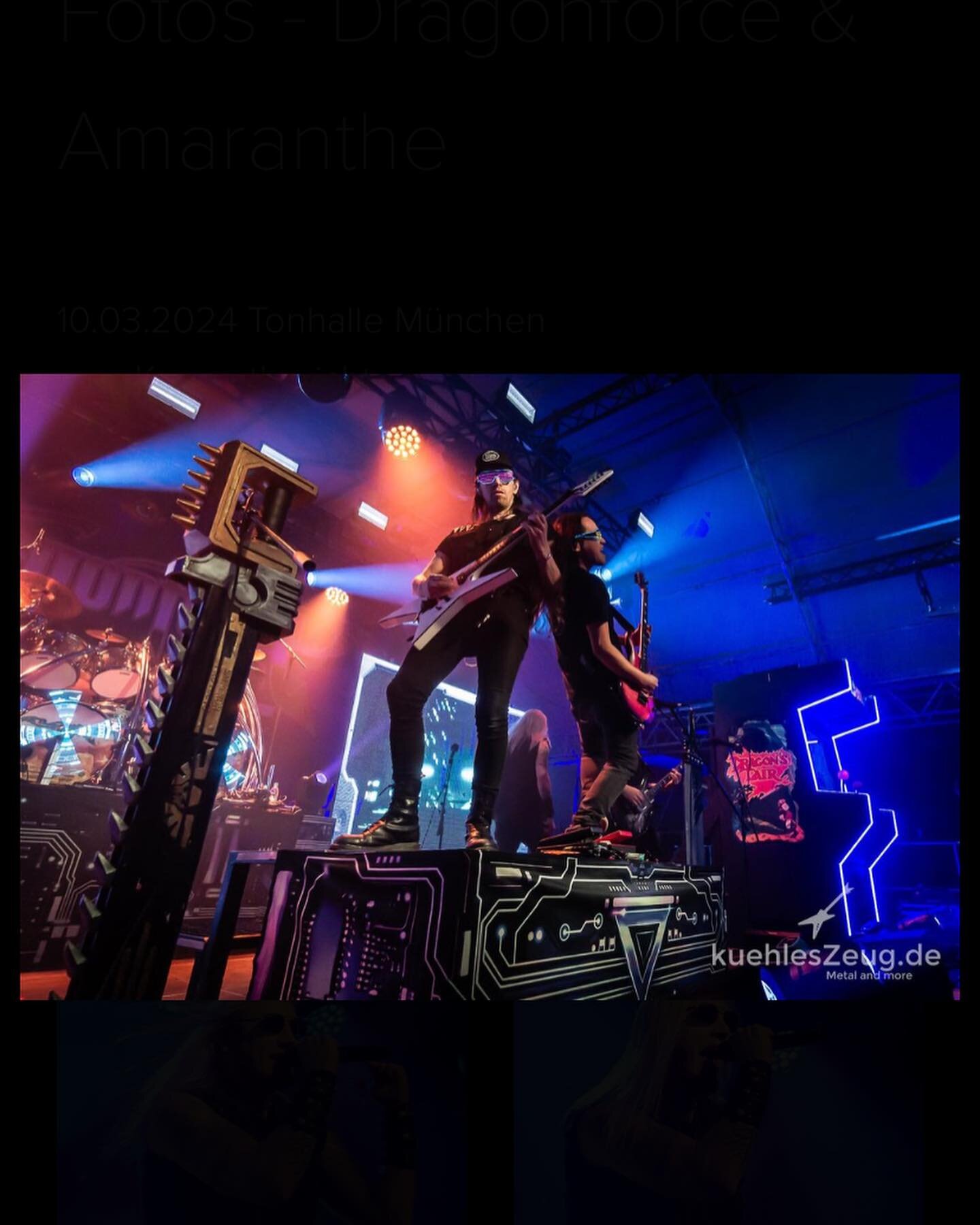Eddie und die Replikanten: wir steigen in die Zeitmaschine mit Iron Maiden
/29.07.2023 Frankfurt und 01.08.2023 München
Die vergangene Zukunft! Das kann man wahrlich nicht überall bestaunen – und wenn das das vielversprechende Motto einer ganzen Gastspielreise der gar nicht mehr jungen Herren um Mr Harris ist, sind wir natürlich dabei. Als ob wir das sonst nicht gewesen wären…
Eigentlich sind wir im Grunde unseres Herzens ja entscheidungsschwach. Als sich also die Frage stellt, ob wir denn die Ansetzung in Frankfurt (Samstag, aber halt Anreise) oder in unserer schönen Landeshauptstadt (vor Ort, aber Montag) wahrnehmen, machen uns das ganz einfach – und nehmen einfach beides. Schließlich stehen wie immer ganz große Großtaten zu erwarten: als vor einigen Monaten die ersten Bildchen auf den sozialen Medien kursierten, die auf die neue Maiden-Tour verwiesen, fanden Kundige eindeutige Hinweise in einer kleinen Anzeige ganz im Hintergrund. Da stand zu lesen „Results: Cyborg: 5 – Samurai 5“, was wir doch flugs entschlüsselten: offenkundig planten die Herren, uns erneut eine Mischung aus Senjutsu und klassischem Material zu kredenzen, dieses Mal vom Sci-Fi-Epos „Somewhere in Time“ von 1986. Wie bei Bilbos Geburtstag war der Aufregung in Hobbiton kein Ende, als sich dann die Folgefrage stellte, ob wir denn endlich auf das niemals live zu Gehör gebrachte Epos um den großen Alexander hoffen durften. Und siehe da: die sozialen Medien enthüllten, dass „Alexander the Great“ endlich erstmals überhaupt die Setlist zieren wird. Also nichts wie los, wir begeben uns in die parallelen Funkhäuser in die Austragungsorte Frankfurt und München, wo die Festhalle und die Olympiahalle mit jeweils um die 15.000 Plätzen die gleiche Anzahl Schlachtenbummler aufnehmen – mit der Ausnahme, dass es in München am Folgetag gleich nochmal ein Zusatzkonzert gibt, womit an diesem verlängerten Wochenende sage und schreibe 45.000 Zuschauer das Spektakel erleben dürfen. „The Future Past“, so nennt sich die Gruppenreise in Anlehnung an den „Senjutsu“-Song „Days of Future Past“, der wieder auf den zweifelsohne besten X-Men-Film referenzieren dürfte. Oder auf die Zeitmaschine. Egal.
In jedem Falle stehen wir jeweils nach kluger oder sogar privilegierter Parkierung rechtzeitig vor der Halle und sichern uns damit einen Platz mit wahlweise Kurzdistanz zur Bühne (in Frankfurt sind wir fast „first to the barrier“) oder mit einem allumfassenden Panoramablick. Den Leibchenstand meiden wir aufgrund doch sehr ambitionierter Preisvorstellungen (in München gibt es wenigstens schmucke Getränkebecher mit Tourlogo, da greifen wir dann doch zu) und legen fest, dass wir uns irgendwo „zwischen“ postieren, was eine hinreichend genaue Positionsbeschreibung liefert. Bevor die Hauptattraktion des Abends ansteht, hören wir gefühlt drölfzig Mal die gleichen Songs von der offenbar immer gleichen Kassette – irgendwann ab der fünften Wiederholung geht uns „Radar Love“ doch ein wenig auf die Nerven, gut nur, dass wir endlich wissen, dass die Kombo Golden Earring hieß und aus Holland stammte. Pünktlich um 19:30 gilt es dann endlich zunächst die Opener The Raven Age zu bestaunen. Hier verrichtet bekanntlich George Harris, der Filius des Maiden-Cheffes Steve Harris, an der Sportguitarre seinen Dienst. Die Herren kennen wir schon vom seligen Rockavaria und auch als Support von Anthrax, und auch heute Abend steigen sie durchaus beherzt in ihr Set ein, wobei der Sound doch arg gewöhnungsbedürftig ist. Mit „Parasite“, „Nostradamus“ und „Forgive And Forget“ ballern sie ordentlich los, Herr Harris macht eine ordentliche Figur, Shouter Matt James fordert uns wiederholt auf „make some noise“ und schraubt sich in ordentliche Höhen. Das stampfende Material leidet zwar etwas unter dem dumpfen Sound, aber immer wieder blitzen Maiden-artige Harmonien und eingängige Refrains auf, die „7th Heaven“ und vor allem „Grave of Fireflies“, zu dem der gute Matt die Halle erfolgreich zu einem Handy-Lichtermeer animiert, durchaus gut reinlaufen lassen. Nach 45 Minuten ist Schluss, in München dankt Herr James noch dem ganzen Tross für die Tour, die für The Raven Age hier und heute zu Ende geht. Stimmt, morgen stehen in München die bunten Recken von Lord of the Lost an dieser Stelle. Aber das kennen wir ja schon von der letzten Legacy-Tour.
Kurze Umbaupause, wir tauschen kenntnisreich Informationen darüber aus, was wir gestern, vorgestern und den Tagen zuvor zu Abend gegessen haben, dann geht endlich – nach diversen weiteren Malen „Radar Love“ - das gelbe Licht an, die Kassette wird gewechselt, und das mittlerweile obligatorische „Doctor Doctor“ tönt vom Band. Die Menge geht sofort steil, von allgemeinem Mitsingen und Klatschen bis hin zu ersten massiven Bewegungswellen. Beim Introlied. Vom Band. Das gibt es eben nur hier. Dann heißt es Licht aus, aber noch nicht Spot on: erst erklingt ein weiteres Intro, sehr passend gewählt - getreu dem Motto des Abends weht da zu einer wandernden Neon-Beleuchtung das Abspann-Thema aus dem epochalen „Blade Runner“ von Vangelis über uns hinweg, jenem Kinomeilenstein, von dem sich die Kollegen seinerzeit zum Cover und einigen Songs von „Somewhere in Time“ inspirieren ließen. Dann fällt nach einem deutlich zu vernehmenden Ticken der Uhr der Startschuss: noch vom Band kommt das Intro wunderbaren Album-Openers, mit dem Maiden seinerzeit durch den Einsatz von Synthesizern ja durchaus den Zorn von Hartkern-Fans auf sich zogen. Rechts und links des Backdrops erscheinen animiert der schon erwähnte Cyborg- und Samurai-Eddie, die wohlig an die Arcade-Games der 80er erinnern – und dann preschen sie mit einem krachigen „Caught Somewhere In Time“ dahin. Diesem Album kam ja seinerzeit die schier nicht lösbare Aufgabe zu, dem Höhepunkt des Schaffens nachzufolgen, den sie mit „Powerslave“ gesetzt hatten. Seinerzeit schlug man eine leichte geänderte Gangart ein, setzte auf einen behutsam angepassten Sound und ging weg von den Messer-Riffs und melodisch-aggressiven Solo-Einlagen hin zu den Griffbrett-Triolen-Abfahrten, die vor allem Dave Murray zelebrierte. Das kommt auch heute bestens zum Tragen, zusammen mit Adrian Smith inszeniert Onkel Dave, bei dem man immer mehr erwartet, dass er uns zum Kaffeekränzchen einlädt und ein geschmiertes Brot reicht, das Zeitreise-Epos unbestechlich.
Da stört das alberne Geturne von Herrn Gers auf der anderen Seite der Bühne gar nicht weiter. Chef im Ring Harris (der anscheinend gar nicht genug bekommt, am eigentlich freien Sonntag gastierte er mit seiner Nebenkombo British Lion noch schnell im Backstage) dräut wie immer mit kurzen Hosen, festem Schuhwerk, West Ham-Bass nebst gepolstertem Tragegurt und singt wie eh und je jede Silbe mit. Aber jetzt Bühne frei für den Front-Derwisch und Tausendsassa Bruce Dickinson: der ex-Flugkapitän (die 747 Ed Force One hat man eingemottet), Buchautor, Podcast-Moderator und was weiß ich noch alles springt umher wie ein Flummi – und hat dabei einen astreinen Trenchcoat ausgegraben, mit der er seinerseits wirken soll wie der Blade Runner Rick Deckart persönlich, der gerade wieder mal Jagd auf Replikanten (also nicht von Menschen zu unterscheidende Androiden) macht, was allerdings durch die schwarze Schweißerbrille und den Haarzopf ein wenig in Richtung Karl Lagerfeld in einer Cyberpunk-Ausführung kippt. Egal, wichtig ist, dass der Kollege mit seinen 64 Jahren immer noch auf der sprichwörtlichen stimmlichen Höhe liegt – was bei den Kapriolen, die Maiden-Songs erfordern, alles andere als einfach ist. Damit also der zweite Bruce, der in München dem Alter zu trotzen scheint, wobei heute im Gegensatz zu letzter Woche keine Verwechslungen vorkamen und keinerlei Springsteen-Kutten zu entdecken sind. Die Bühne ist wie gewohnt spektakulär, mit einer futuristischen Stadtkulisse, bei der wechselnde Backdrops ergänzt sind von zwei digitalen Videostreifen rechts und links, die das Bild jeweils beweglich ergänzen. Im Maiden-Lager gibt es dabei offenbar die ganz eigene Job-Beschreibung Backdrop-Designer: über die Detailfreude und den Anspielungsreichtum dieser Bühnengestaltung kann man nur noch staunen. Die Blade Runner-Stadtansicht, die die Rückseite des „Somewhere In Time“-LP-Covers zierte, kommt beim Auftaktstück zu ehren – dabei gibt es Schilder mit „Saturn Shuttle“ und „Moon Shuttle“ zu bestaunen, bei den Ruskin Arms wird das Trooper IPA ausgeschenkt, eine Digitaluhr zeigt „23:58“ (na? 2 Minutes to Midnight, richtig!), man kommt gar nicht dazu, alles genau aufzunehmen – denn zumindest in Frankfurt wird die Waschmaschine nun ordentlich angeworfen. Aber wir halten Kurs und gehen freudig in den bassgetriebenen Stampfrhythmus des „Stranger In A Strange Land“, zu dem die animierten Backdrops eine Western-Saloon-Szene vorführen, die dem Cover der damaligen Single entnommen ist. Passend zur Mär, die ihren Titel vom epochalen Sci-Fi-Roman aus der Feder von Robert A. Heinlein entlehnt, erscheint ein erstes Mal das Bandmaskottchen: in Schlapphut und Ledermantel lehnt da ein Cowboy-Eddie am Rande der Bühne. Das lange nicht gehörte Stück knallt auch heute wieder ordentlich, entfaltet durch die getragenen Strophen einen ganz epischen Charme und zeigt, dass der Maiden-Fundus an Schätzen schier unerschöpflich scheint. Jetzt wendet sich der Zeremonienmeister dann erstmals auch direkt an uns, wobei wir als aufmerksame Zuhörer feststellen können, dass der gute Bruce seine Ansagen durchaus auf die jeweilige Location abstimmt. Mit dem Zug sei er angereist, „I came by Sssug!“, und er habe in Richtung Hauptbahnhof fahren wollen, sei aber in „Frankfurt Sud!“ gelandet, so informiert er uns im Hesseland, während man in München am Vorabend „your beautiful city“ erkundet und dabei jede Menge Wurst gegessen und natürlich auch Bier getrunken habe, „all of it excellent – your contribution to world culture, sausage and beer!“, so trägt er grinsend vor, um dann mit beiden Geschichten auf die Zielgerade zu biegen: sowohl beim Sssug-Fahren als auch in der bayrischen Boazn habe man wohl die Hinweisschilder nicht beachtet: „we did not see the writing on the wall!“
Damit leitet er über zum gleichnamigen Stück von Senjutsu, das die biblische Mär von Menetekel an der Wand, bei dem der gute Belsazar bei seinem Gelage gewogen und für zu leicht befunden wurde, in eine düstere Anti-Utopie ummünzt. Vom akustischen Intro, getragen vorgeführt von Bluesmeister Adrian, über die treibenden Strophen bis hin zum epischen Refrain wird hier allererste Qualität geboten. Die Grandsigneurs des Metal liefern ab, die Zeitmaschine scheint real: von Altern ist hier keine Spur, rostfrei strahlt die Maschine wie eh und je. Stichwort Zeitreise: diese leitet der gute Bruce nun launig ein, er sei aus einer anderen Dimension, immerhin sei er gestern schon da gewesen und wir nicht – „you have all seen Oppenheimer, you know Black Holes!“ Nun, dieser Logik muss man nicht unbedingt folgen, aber wir Deutschen verstehen doch jede Menge von Autos, vor allem in München, „BMW – you make them here!“, was unsere kleine Reisegruppe durchaus bestätigen kann, aber es gebe halt nach wie vor nur ein einziges Auto, was durch die Zeit reisen könne: „the DeLorean! It was completely ineffective and totally useless, only two were ever sold” – aber natürlich konnten Doc Brown und Marty McFly dank Flux-Kompensator mit diesem Gefährt bekanntlich zurück in die Zukunft reisen, was wir nun mit der „Time Machine“ von Senjutsu ebenfalls tun – für die wahre Zeitreise braucht man eben nur Musik und Phantasie. Auf Platte ein wenig sperrig, gerät das Stück (Time Traveller, sozialistisch angehauchte Anti-Utopie von Mr Wells, verweichlichte Eloi und verrohte Morloks, man kennt das ja) mit akustischem Intro, wabernden Strophen und Hüpf-Melodie-Attacken zum Kracher, bei dem wir erneut das Backdrop bestaunen, auf dem drei Datumsangaben zu lesen stehen: 25.12.1975 (erster Auftritt der Kombo im Cart & Horses Pub), 03.09.2021 (Erscheinungsdatum Senjutsu) und als „Retro“ noch der 29.09.1986, an dem „Somewhere In Time“ herauskam, alles umrahmt von diversen Zahlencodes, einer Angabe der Flux-Werte (ja!) und etwas versteckt dem Namen „Nostromo“, jenem Raumschiff, mit dem die unglückliche Besatzung in Alien unterwegs war. Und ganz im Eck erspäht man eine blaue Telefonzelle, die unschwer als die TARDIS des zeitreisenden Dr. Who erkennbar ist. Man haut kaum – nun ja, Zeit, alles zu entschlüsseln, da galoppiert der Tross schon weiter in Richtung der nächsten Gabe, die uns in Form des lange nicht gehörten Klassikers um den ewigen Gefangenen Nummer 6 entgegenschlägt.
Garniert mit Szenen aus der legendären TV-Serie, in der Patrick McGoohan Ende der 60er eine Allegorie um Selbstbestimmung, Fremdkontrolle und sozialem Unbehagen kredenzte, steigen wir ein in die alte Dampframme vom „Number of the Beast“-Album, dessen Refrain („I’m not a prisoner – I’m a free man“) auch der letzte im Pit mit anstimmen kann. Dass das Backdrop ikonische Motive aus der Serie enthält, wie das Hochrad und die seltsam künstlichen Gebäude, das bekommen wir noch zusammen, aber zum Schachbrett erhellt uns dann der mit angereiste Filius eines Kompagnons: aufgestellt ist hier wohl eine klassische Eröffnungssituation namens „Schäfermatt“ (englisch „Scholar’s Mate“), mit der ein erfahrener Spieler einen weniger versierten Gegner in vier Zügen matt setzen kann. Das dürfte dann wohl auf die Folge „Checkmate“ der Serie verweisen, in der Nummer 6 einmal mehr einen – natürlich erfolglosen – Fluchtversuch startet. Der Menge mag es egal sein, umso schöner, dass man so viel zum Entdecken anbietet. Prospekt und dank an den jungen Schachprofi, der uns hier in Kenntnis setzt! „Be Seeing You“, zwinkert uns Nummer 6 noch zu, aus. Jetzt schwingt Bruce eine schmackige Rede darüber, dass Völkermord kein neues Phänomen sei, sondern immer wieder mal versucht wurde, so etwa als die Römer die Kelten auszulöschen versuchten. Dass das unweigerlich schief geht, sieht man ja, so erklärt er uns, an den zahllosen Irish Pubs, von denen Meister Gers jeden einzelnen kennt – „as long as there is language, culture, family, you cannot kill that!“ Wir stimmen zu und bestaunen nun den „Death Of The Celts“, einen typischen Vertreter des Prog Metal, den Maiden spätestens seit dem Book Of Souls-Album bis zur Perfektion zelebrieren: episch, getragen beginnend (wozu Bruce ein kleines Folk-Tänzchen aufführt), dann übergehend in verschachtelte Türme aus Rhythmen und Melodien, die so gar nichts mit dem drei-Minuten-Zack-Bumm-Stil zu tun haben, als der Metal gerne von Unkundigen abgestempelt wird. Quasi eine Art Pendant zum „Clansman“ haben wir hier vor uns, mit Schlachtenbild geziert, bei dem rechts und links digitale Feuer lodern. Groß. Jetzt reisen wir wieder in die Zeit, Bruce führt aus, dass man das nächste Stück „here in Munich“ recorded habe, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem viele in der Halle hier noch gar nicht über die Erde wandelten: „This song is from an album called Seventh Son Of a Seventh Son! We made it in 1988, who was not born then?“ Hier melden sich jede Menge junger Leute, wir gehören allerdings gerne zu der Fraktion, die 1988 a) schon geboren und b) schon bei Monsters in Schweinfurt zugegen war, wo Maiden die damals neue Scheibe im Gepäck hatten. Wie dem auch sei, „Can I Play With Madness“ – auf Konserve damals etwas schmalbrüstig – knallt heute ordentlich, mit frenetisch mitgesungenem Refrain und untermalt vom damaligen Video. Fast so schön wie seinerzeit im deutschen Fernsehen, als sie aufgrund ihres Charterfolgs in die Tonbandsendung „Bananas“ eingeladen wurden und aus Protest gegen das verordnete Playback allerlei Schabernack trieben.
Nicko hat seitdem wohl nie mehr den Bass gespielt. Jetzt packen sie dann wieder die große Epik aus, in Form des Stücks, das noch nie zu Ehren kam: als weiteres Beispiel für die letzte Nummer einer Maiden-Platte, die in den 80ern stets die langen, vertrackten Kompositionen aufbot (man denke an „Hallowed be thy name“, „To Tame a Land“ oder natürlich die Weise vom alten Seemann) lieferte „Alexander the Great“ eine fulminante Geschichtsstunde, aus der wir bis heute unsere Jahreszahlkenntnis des Kollegen schöpfen. Warum sie es nie auf die Bühne brachten, bleibt ihr Geheimnis, hier und heute brilliert das Historienwerk vom getragenen Anfang („My son, ask for thyself another kingdom“) über die treibenden Strophen bis hin zum ausladenden Solo-Duell der Herren Smith und Murray (wer war nochmal Herr Gers?) auf ganzer Linie. Wir sind berauscht, und zwar nicht vom Gerstensaft, den es hier wie stets zu meiden gilt. Wir sind ja für die Kunst da, auch wenn das die bürgerliche Presse aus dem Rhein-Main-Gebiet in ihrem Bericht später nicht verstehen wird. Ohne Pause galoppieren wir weiter hinein ins nächste Großwerk von 1986: „Heaven Can Wait“, ebenfalls lange nicht im Set gesehen, reißt mit Hoppelriff alles um, aber natürlich warten wir alle auf das „ohohoh-“Spielchen in der Mitte, zu dem die Halle steil geht. Und dann stakst Eddie endlich wieder über die Bühne, wieder als Cyborg im Somewhere in Time-Look, Laserpistole im Anschlag, aber da hat er die Rechnung ohne Bruce gemacht, der ihm aus einer rechts postierten Laserkanone ordentlich Mores gibt. Es stinkt nach Platzpatronen, das ist wunderbarer Zirkus, und wir notieren sehr wohlwollend, wie leicht ironisch Maiden mit den Motiven des Metal, die sie selbst mit begründet haben, spielen – das alles ist ein kleiner Jahrmarkt, der allerdings nie albern, sondern immer voller Wissen und auch Gravitas zwischen Show und Kunst changiert. Das setzt sich nun fort, vor dem Backdrop des Waldschrat-Eddie erzählt uns ein kapuzenbewehrter Bruce, dass er sich im Dunkeln fürchterlich ängstige – „Fear Of The Dark“ gehört längst zum festen Repertoire, verwandelt die Halle in den sprichwörtlichen Hexenkessel und wirft zumindest in Frankfurt die Waschmaschine vorne nochmal ordentlich an. Und dann Kehrtwende zurück zu den ruppigen Anfängen, „Iron Maiden“ prescht wie immer räudig dahin, die Frage ist eigentlich immer nur, in welcher Form uns das Bandmaskottchen beehren wird: und natürlich stakst nun ein Samurai-Eddie über die Bühne, während sich hinter Nickos Drumkit ein gewaltiges Senjutsu-Antlitz aufbläst. Eddie verwickelt Dave (Frankfurt) oder Herrn Gers ein spaßiges Schwet-Duell, Meister Harris dräut – dann heißt es wie gewohnt „good night from Iron Maiden, from Eddie, and from the boys“, wobei sich Bruce explizit auch wieder an uns wendet – immerhin sind wir die „mad motherfuckers down in the front“. Natürlich geht die Sause noch in die Verlängerung: eher getragen setzt die Schlussnummer von Senjutsu, „Hell On Earth“ ein, mit Akustikbass vor einem apokalyptischen Backdrop, in dem eine Freiheitsstatue mit Eddie-Gesicht vor einer zerbombten Landschaft im Sand untergeht – der „Planet der Affen“ lässt grüßen. Während sich das Stück dystopisch in typischen Maiden-Melodien entfaltet, erscheint auf der digitalen Wand rechts nach und nach aus der Sandwüste der Grabstein, den wir mitsamt Lovecraft-Spruch „That is not dead which can eternal lie“ vom Live After Death-Album kennen.
Die Mär vom Krimkrieg „The Trooper“ feuern sie wie immer beherzt ab, umrahmt von Szenen aus dem Errol-Flynn-Leinwandabenteuer „The Charge Of The Light Brigade“, wobei der eine oder andere im Publikum im Kavallerie-Rock mitgeht und Adrian in München ein witziges Schaukelpferdchen auf der Gitarre umherführt. Schluss- und Glanzlicht liefert dann die ultimative Zeitreise „Wasted Years“ – immer Blick voraus, mahnt uns Bruce, die Backdrops werfen nochmal die Zeitmaschine an, auf den Videoleinwänden flimmern Eddie-Ausgaben von diversen lokalen Tourneen umher, dann ist endgültig Feierabend. In München freut man sich auf Nacht 2, wir verabschieden uns und möchten den Recken auf der Bühne am liebsten wie Rick Deckarts Kollege nach geschlagener Schlacht zurufen: „You’ve done a man’s job! I guess you’re through, eh?“ Worauf wir von Bruce nichts anderes als ein genuscheltes „Finished“ erwarten. Aber das machen wir nächstes Mal.