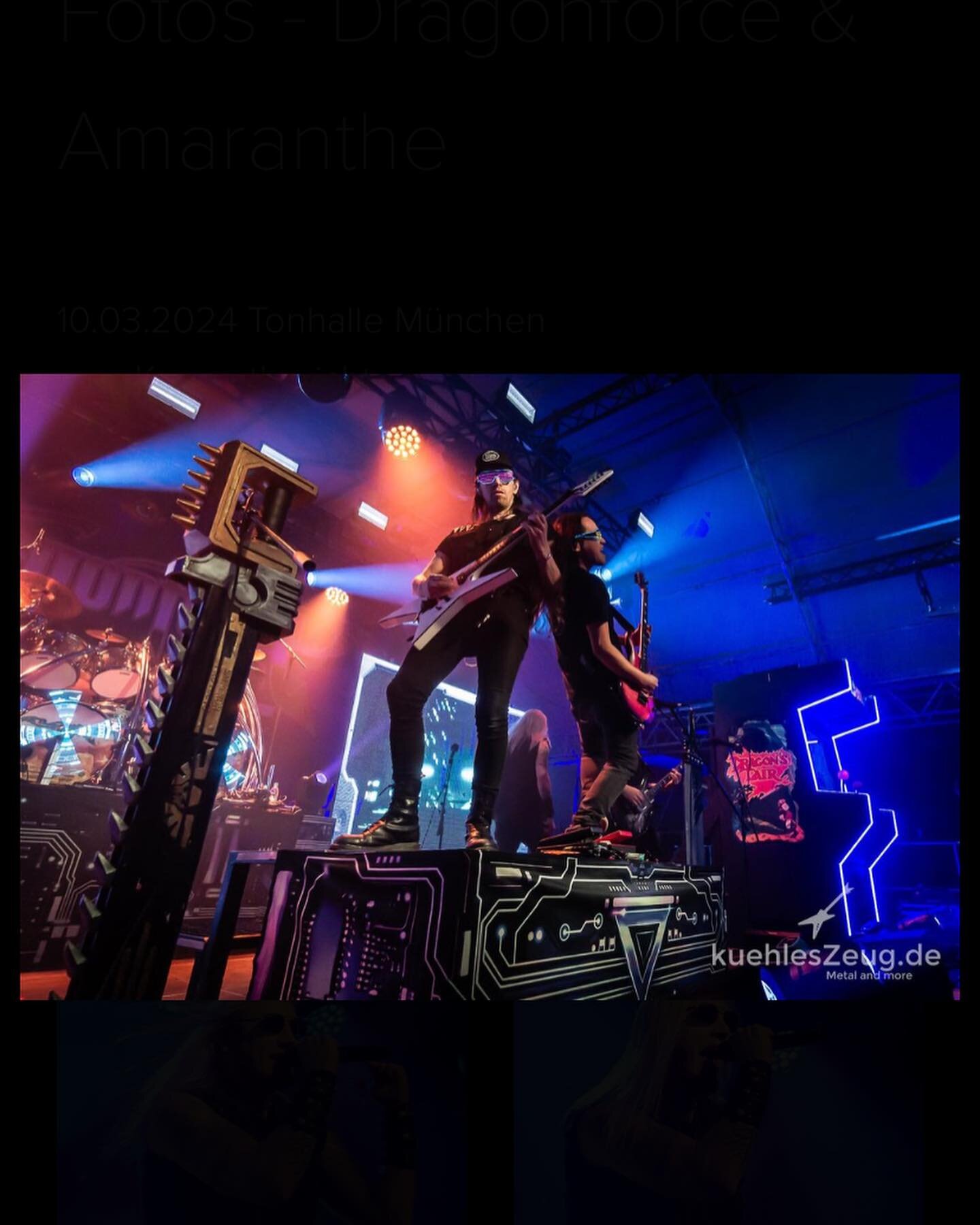Heavy Progging und kulturelle Vielfalt: Symphony X, Myrath und Melted Space im Feierwerk
/08.03.2016, Feierwerk, München
zu den Fotos
Wo genau ist dieses Bild möglich: des Abends stehen Altrocker und Jungspund, Fremder und Bayer, Männlein und Weiblein in Eintracht zusammen – also besser gesagt drängen sich dicht an dicht – und lauschen beschwingten Klängen aus Frankreich, Tunesien und den USA. Sind wir auf einem von linken Intellektuellen organisierten Fest der Kulturen in der Hauptstadt? Nein. Nein, das ist der zutiefst basisdemokratische und völkerübergreifend integrierende Effekt des Metal: Solange der Sound passt, sind kulturelle Unterschiede halt Nebensache und das ist erstens gut so und zweitens uns ganz recht so.
Melted Space - zu den Fotos
Und diesen Effekt kann man hier und heute Abend im Feierwerk beobachten, einer kleinen aber feinen Location, die Kollege Sebbes auskunftsgemäß vor Jahrzehnten schon einmal für ein Gastspiel von Graveworm aufsuchte, wo er dann mit der Band mehr oder weniger alleine feiern konnte. Das ist heute ganz und gar nicht der Fall, denn das kleine, sehr lauschige Hansa 39 im Feierwerk ist gleich von Beginn an ganz achtbar gefüllt, als die Franzosen von Melted Space auf die überschaubare Bühne kommen und gleich ordentlich loslegen. Nach einem mystischen Intro schwingen sich die Herrschaften in die Klänge ihrer metallischen Oper The Great Lie, auf der Mastermind Pierre Le Pape ein Werk vorgelegt hat, das durch seine stilistische Bandbreite ebenso beeindruckt wie die schiere Anzahl an Mitwirkenden (also ich habe 26 gezählt). Inspiriert von der klassischen Oper, erzählt das Konzeptwerk eine durchaus tragische Geschichte, die wir heute in doch arg kurzen 25 Minuten in der Reader’s Digest Fassung erleben. Dabei reisen wir einmal quer durch alle Stilrichtungen, von Power über Gothic bis hin zu Death, hören jeden erdenklichen Gesangston – „wie viele Sänger haben die denn?“, fragt Sebbo zu Recht: es sind drei, und die bringen klar, Oper und growl an den Mann/Frau – und wundern uns über die Komplexität, die hier schon zum Auftakt geboten wird. Der Sound ist nicht optimal, aber dennoch gefällt diese Mischung, die teilweise an ganz frühe Gathering erinnert, ganz hervorragend, so dass die Kollegen nach ihrem kurzen Ausritt weidlich beklatscht verabschiedet werden.
Der Austragungsort wird nun minütlich voller, es reihen sich durchaus viele intellektuelle hornbrillenbewaffnete Gesellen ein, die sich wahrscheinlich sonst Jazz, Pink Floyd oder noch schlimmeres (falls es das überhaupt gibt) zu Gemüte führen – und mit Myrath geht der Reigen der Farbtupfer nun gleich weiter, denn die Formation stammt aus Tunesien, was ja nun üblicherweise nicht gerade als Mekka des Metal bekannt ist. Umso überraschender, dass diese Herrschaften – die übrigens ihr Equipment selbst aufbauen – nicht erst seit gestern, sondern schon seit 2001 im Geschäft sind und ihr Handwerk famos verstehen. Im heutigen Paket sind die mehr als passend, nachdem sie zu Beginn ihrer Karriere in erster Linie Covers der selbst erklärten Lieblingsband Symphony X darboten. Stimmig also, und nach einem ordentlich vernebelten Intro geht es gleich zünftig zur Sache, und erster Blickfang ist Shouter Zaher Zorgati, der einem gewissen metallischen Comedian derart ähnlich sieht, dass man gleich um die Ecke die wilden Kreatüren des Herrn Ceylan vermutet – zumal der Kollege auf der Bühne sehr achtbares Deutsch auf Lager hat.
MYRATH - zu den Fotos
Wer hier nun verkopfte Folklore erwartet, sieht sich getäuscht: geboten ist grooviger, durchaus eingängiger Power Metal mit leicht progressiven Einsprengseln, der vor allem bei aktuellen Nummern wie dem sehr melodischen „Believer“ zu ersten echten Begeisterungsstürmen Anlass gibt. Bei „Nobody’s Life“ avanciert Basser Annis Jouini mit seinem sechssaitigen (!) Tieftöner kurzzeitig zur Hauptattraktion, aber auch Keyboarder Elyes Bouchoucha macht mit seiner runden (!) Orgel der Marke Kurzweil einiges her. Die Stimmung ist damit mittlerweile bestens, Songs von den Alben Desert Call, Tales of the Sands und dem brandneuen Werk Legacy laufen bestens rein, wobei die orientalischen Einflüsse stets zu spüren, aber niemals aufdringlich wirken. Aber auch hier ist nach 30 Minuten leider schon Schluss, und die lauthals vorgetragenen „Zugabe“-Rufe kann Sänger Zaher (der sich in der ersten Reihe erkundigt, was denn das bedeuten soll) nur mit einem kleinen „tut mir leid“ quittieren kann. „Super Sache!“, urteilt mein Mitstreiter, und das lasse ich jetzt mal einfach so stehen. Weil richtig.
Symphony X - zu den Fotos
Jetzt wird es dann mal so richtig voll, jeder Winkel des Saals füllt sich mit Schlachtenbummlern, denn immerhin kündigt sich nun die Hauptattraktion des Abends an. Ich bin durchaus verwundert, welch generationsüberspannende Anziehungskraft die US-Prog-Institution Symphony X ihr eigen nennt: vor mir stehen junge Damen, die man eigentlich in einschlägigen „Clubs“ erwarten würde, während in den hinteren Reihen auch ältere Semester angereist sind, die ansonsten wohl eher den Tatort bewundern. Sei’s drum, wir bestaunen einstweilen den Bühnenaufbau, wo man seitlich Mikrofone ins Publikum richtet (wird hier etwa ein Live-Mitschnitt vorgenommen?), jede Menge Wasserflaschen aufstellt und blaue Handtücher verteilt. Weil mir ham ja an Ding, an Stil, gell. Nach einer weiteren massiven Nebelflut gibt es eine kleine Ofentüre, bevor die Mannschaft dann mit „Nevermore“ kraftvoll und mit massiver Lautstärke einsteigt. „Die blasen alles weg!“, konstatiert Tontechniker Sebbo, der sich wie immer über die fürchterlichen Lichtverhältnisse beklagt, aber dennoch – ebenso wie immer – unverdrossen den Auslöser betätigt. Der in jeder Hinsicht gewaltige Sänger Russell Allen legt sich voll ins Zeug, bewehrt mit einer stylischen Sonnenbrille macht er uns den Geoff Tate aus besseren Tagen, posiert und schwingt sich in treffliche Höhen und inszeniert den Auftakt mitreißend und kraftvoll. So geht es mit „Underworld“ nahtlos weiter, und wir können über die Spielfreude und Versiertheit des Saitenhexers Michael Romeo nur staunen (ein paar weniger Duplos könnten nicht schaden, aber das lassen wir jetzt mal). Meister Allen erläutert uns nun in bestens aufgelegten Worten, man brauche ja immer sehr lange zur Vollendung eines Albums – zustimmende Zurufe aus dem Publikum -, aber man wolle ja etwas Gescheites abliefern. Recht so, und absolut zutreffend beim aktuellen Konzeptalbum Underworld, dessen Story Herr Allen uns nun näherbringt: ein junger Mann folgt seiner Geliebten in die Unterwelt, „old evils in a new world“, das Ganze kennen wir irgendwoher, und wie für Orpheus geht das natürlich nicht gut aus.
Umso besser mundet uns die musikalische Umsetzung dieser Reise, die mit dem brachialen „Kiss Of Fire“ und vor allem der gefühlvollen, ausladend-epischen Ballade „Without You“ ihre szenische Fortsetzung nimmt. Die Menge ist mittlerweile komplett aus dem Häuschen, Mr Allen nimmt Brille und Haargummi ab, kommentiert lobend, wie viele Menschen doch in einen kleinen Raum passen, und gibt uns dann den Fährmann des Todes, den er bei „Charon“ mit Mikroständer als Ruder treffend mimt. Das Kernstück der Aufführung bildet dann das massive „To Hell And Back“, das Allen mit weißer und roter Tragödienmaske (weiß für den fliehenden Orpheus, rot für Hades, vermuten wir) wie eine kleine Oper inszeniert und die musikalische Brillanz optisch kongenial untermalt. Eindrucksvoll dabei seine vokalistische Bandbreite, die von klassischem Metal-Gesang bis hin zu finsterem Knurren und Hochtönen reicht. „Run With The Devil“ knallt dann wieder gehörig ins Kontor, bevor uns Mr Allen dann erklärt, warum alle ein wenig müde sind: Saitenmeister Romeo hatte gestern Geburtstag, den man im Hofbräuhaus begangen hat, wo man ihnen „so viel Bier verkauft hat, wie das eben möglich ist, ohne verhaftet zu werden“. Mein Herr, wir sind hier in Bayern, da kommt man eher dafür in den Knast, wenn man auf der Wiesn ein Pils bestellt - also weiter im Text mit dem Ende der Unterwelt-Saga, dem Epos „Swan Song“, das Mr Allen lakonisch kommentiert: „at the end, he cannot save her. Life’s a bitch“. Mag sein, aber auch dieser Song zerrt die Wurst wieder enorm vom Brot, und nach einer furiosen Stunde ist erst einmal Schluss. Soeben haben wir also das gesamte aktuelle Album am Stück erlebt, was man sich als Band auch erst einmal trauen muss – in Gänze gespielt werden üblicherweise ja nur die Klassiker aus der Historie. Egal, diese Herrschaften dürfen das, das Volk ist verzückt, und jetzt kommen sie ja auch schon wieder.
Symphony X - zu den Fotos
Nach einer kurzen Frickelattacke und einem kurz angespielten „March of the Storm Troopers“ (das finstere Thema aus Krieg der Sterne, alles klar?) feuern sie uns „Out Of The Ashes“ um die Ohren, eine ruppige Nummer mit Gerammel-Ansätzen, bei der Herr Allen eine Flasche Landbier schwingt. A man of taste, indeed! Nach dem ebenso furiosen „Sea Of Lies“ verabschiedet sich die Kombo dann doch für eine kurze Intermission, die allerdings nach wenigen Momenten vorüber ist. „Set The World On Fire“ führt dann endgültig zum kollektiven Ausrasten, bevor das Ronnie James Dio gewidmete „Legends“ den Reigen bunter Melodien beschließt. Kolossale Leistung einer Kombo, die technisch auf höchstem Niveau agiert und dabei aber Eingängigkeit und Struktur nie vernachlässigt. Und die ganz offensichtlich jede Menge Freude an dem haben, was sie da so treiben. Und die hatten wir auch. Ob sie danach nochmal ins Hofbräuhaus gingen, entzieht sich allerdings unserer Kenntnis.