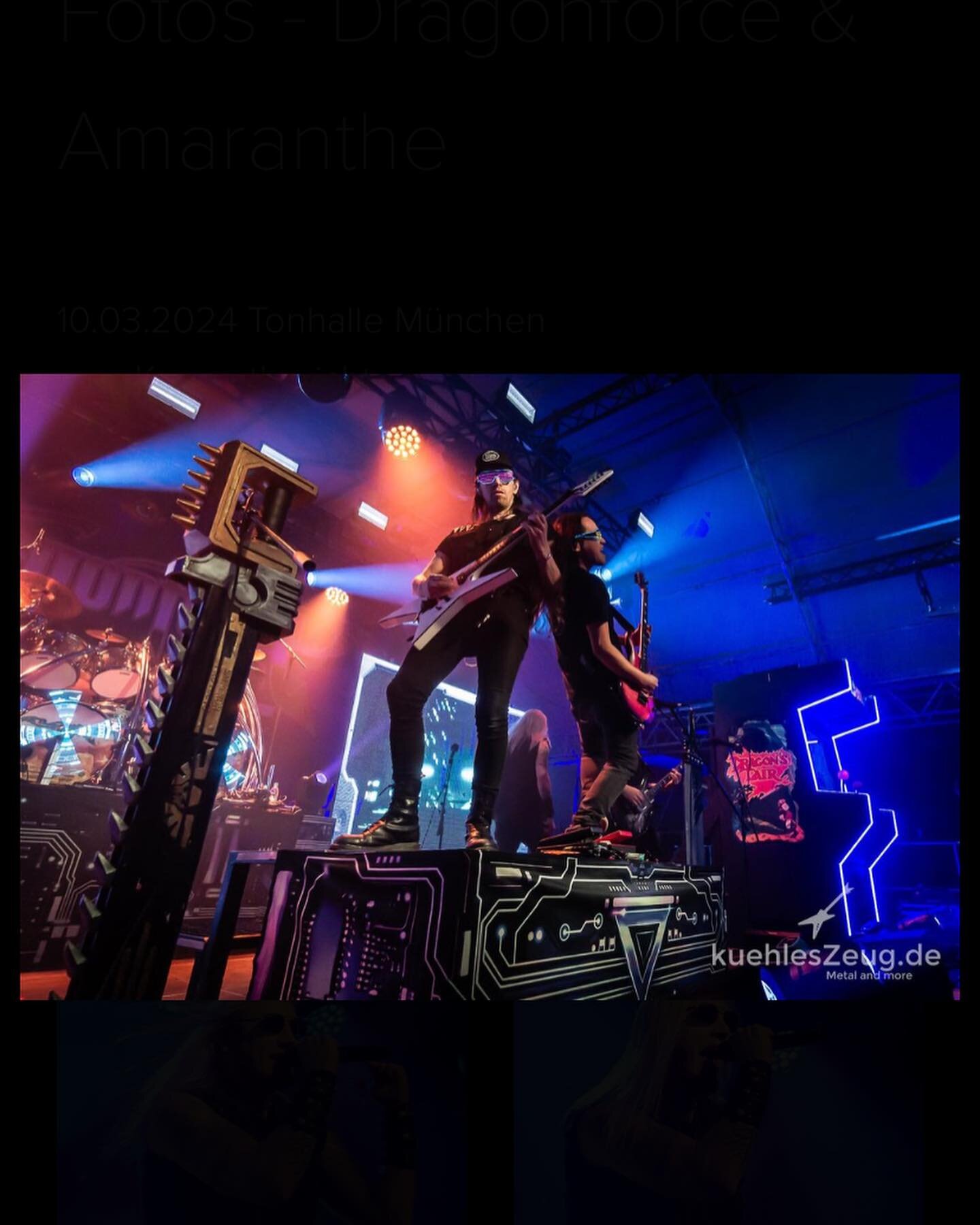HEINO - der schwarze Enzian rockt das Backstage
/8.10.2015 Backstage München
Heinz Georg Kramm war in seiner 50jährigen Karriere schon vieles: erfolgreich, populär und dann komplett out. Für meine Altersgenossen war er vor allem Zielscheibe des Spotts und die Inkarnation dessen, was so überhaupt gar nicht ging: als ewig blonde, dunkel bebrillte Kunstfigur Heino lieferte er den Soundtrack für die Eiche-Massiv-Schrank-Wohnzimmer unserer Großeltern, mit Schäferhund-Bergromantik-pseudo-Volksmusikschlagern schrammte er bisweilen nah an der Deutschtümelei vorbei und dürfte wohl zu den meist parodierten Musikern überhaupt zählen, am eindrucksvollsten durch den "wahren Heino", der im Vorprogramm der Toten Hosen zu sehen war und erst nach einer Klage verschwand. Nach dem durchaus zähen kommerziellen Aufflackern des als Volksmusik getarnten Schlagers in den späten 80ern und 90ern, als die Privatsender von entsprechenden Sendungen nur so rauschten, verabschiedete sich Herr Kramm 2005 von den deutschen Bühnen, und eigentlich hätten wir nie mehr an ihn gedacht.
Bis schließlich 2012 die Nachricht die Runde machte, die neue Heino-Platte habe die Charts gestürmt, mit mehr Downloads als je ein deutscher Künstler zuvor. Auf Mit freundlichen Grüßen servierte er einen genialen Coup: er interpretierte mit seiner ja zweifelsohne markanten Stimme deutsches Liedgut. Soweit nichts Neues. Aber dieses Mal war es eben nicht der Regenbogen-Johnny oder Die schwarze Barbara, sondern Pop- und Rock-Songs. Seine Fassung des Ärzte-Knallers "Junge" funktionierte vor allem in seiner Interpretation, weil er eben genau die bigotte Generation verkörpert, über die sich das Stück amüsiert. So kongenial passt sein dunkles Timbre zu Rammsteins "Sonne", dass er 2013 mit den Herren in Wacken livehaftig auf der Bühne stand und seine wohl größte Publikumsmenge zu Gesicht bekam. Die PR-Maschine (an die sich auch Roberto Blanco anhängte, der in Wacken mit Sodom auftrat und mitteilte, ein bisschen Spaß müsse sein) lief heiß: öffentlichkeitswirksam wurden angebliche Gerichtsverfahren mit den Ärzten geführt (die davon interessanterweise gar nichts wussten), der pinke Hütchenträger mit der Quietschestimme Jan Delay zeigte sich als Spielverderber und zieh Heino des Faschismus (ach woo!!) - und wumms: der Imagewechsel, der oft danebengeht (in den 80ern hatte er es schon einmal mit Rap versucht, und war ebenso gescheitert wie Gotthilf Fischer, der auf der Loveparade nur peinlich wirkte), war geglückt. Er spielt mit dem Klischee, keine Frage, das ist kalkuliert, ja sicherlich, aber 2014 legte er noch einen nach und servierte mit Schwarz blüht der Enzian die Kehrseite: also rockige Fassungen seiner eigenen Evergreens. In einer Zeit, in der seine eigentliche Heimat endgültig untergeht - auch die allerletzte Bastion, der Musikantenstadl, hat sich durch die verhunzte Verjüngung in der Stadlshow das eigene Grab geschaufelt -, geht er also in Lederjacke und Totenkopf-Rollkragenpulli auf Gastspielreise. Das muss man erlebt haben - vor allem, wenn man wie ich einen Leidensgenossen im engeren Bekanntenkreis hat, der aus, wie zu befürchten steht, ernst gemeinter Verehrung nach dem Kollegen benannt wurde (und das ist ausnahmsweise mal kein Gag).
Wir versammeln uns also im Backstage, der Kaschemme, in die der Barde noch vor einigen Jahren keinen Fuß gesetzt hätte, und staunen zunächst einmal über das Publikum: da sind keine verwirrten Menschen, die das alles nicht mitbekommen haben, und auch nur ganz wenige Brillen- und Perücken-Träger, für die das alles ein großer Spaß ist: die meisten wollen das wirklich ernsthaft sehen, und sogar der eine oder andere Kutten- und Nietenarmbandträger ist am Start. Volle Punktzahl schon einmal dafür, dass es keine Vorgruppe gibt - braucht wie schon häufig dargelegt niemand, und in der Waschmaschine sind ja auch die Socken, die wir nachher noch trennen müssen. Also schnell zum Merchandise-Stand, wo die Totenkopf-Motive echte Verkaufsschlager sind, dann zur Bühne, wo das Backdrop ebenfalls das gleiche lauschige Motiv zeigt.
Alsbald entert die Band die Bühne, klassische Rock-Instrumentierung plus Gebläse und drei Chanteusen, die ebenfalls nicht mehr im zartesten Alter sind und damit genau passen. Los geht's mit einem kleinen Intro - und der Sound ist rockig, laut, also nur ein Späßchen wird das nicht heute. Aber dann wird er angekündigt, "eine lebende Legende, aus Deutschland und Los Angeles - der einzige wahre!" Dann spaziert er zu uns, schwarzer Mantel, Totenkopfring, Kreuz um den Hals und auf dem Rücken, ohne die gelben Haare (ob die allerdings echt sind, das darf gefragt werden) könnte er glatt bei Sabbath durchgehen. Den Einstieg macht gleich "Junge", das souverän vorgetragen die Stimmung sofort in die oberen Regionen hebt. Dass hier musikalisch alles in Ordnung geht, daran zweifelte ohnehin niemand - aber kann ers auch? Wie wirkt das live? Peinlich? Aufgesetzt? Nein, in keinster Weise: der Bariton schwingt wohlig, für seine 78 (richtig gelesen) Jahre bewegt er sich locker und agil, und die Nummer kommt schmissig rüber.
Dann beginnt das Spiel mit den Konventionen..."Guten Abend, meine Damen und Herren... aber hier beim Rock darf ich doch sicher sagen: guten Abend, meine Freunde, oder?" Damit hat er uns dann endgültig, dieses bewusste Jonglieren mit dem eigenen, zementierten Bild, das natürlich kommerziell motiviert ist - niemals sonst würde er ein mit fast 500 Leuten gut gefülltes Pfarrheim, Vereinshaus oder gar Backstage sehen -, das ist die Prise, die dafür sorgt, dass die Mischung funktioniert. Er gibt weiter Gas und feuert gleich ein krachiges "Augen Auf!" hinterher, das fetzt richtig los, und immer wieder erwischt man sich bei dem Gedanken, dass man sich über genau diese Figur lustig gemacht hat, mit der man jetzt gemeinsam "Eckstein alles muss versteckt sein!" ruft. "Was soll das?" funktioniert deutlich besser als im Original des Herrn Geröllheimer, bevor der Barde uns dann informiert, nun komme ein Stück, das schon zweimal ein Hit gewesen sei: 1972 in der Ursprungsfassung und dann nochmal in den 80ern als Rap. Und Fassung Nummer drei, die macht jetzt alles platt und bringt das Highlight des Abends: in der schwarzen Rammstein-Gothic-Inszenierung ballert der "Enzian" daher, dass es nur so eine Art hat, schwer, schleppend, fast möchte man dazwischenrufen dass das Herz links schlägt, so hart kommt das Riff. Da tut es nichts zur Sache, dass das von uns so oft verlachte "die ich nie iii iiiiii iiiiiiie" nicht mehr so ganz genau kommt - insgesamt ist ein Sieg auf der ganzen Linie.
Damit ist also die zweite Runde - eigene Songs neu aufgelegt - eingeläutet, "La Paloma" zündet im neuen Arrangement dann nicht ganz so gut, aber "Wir lagen vor Madagaskar" geht dann wieder ordentlich nach vorne. "Rosamunde" erscheint mit Bläser-Einsätzen im Ska-Gewand, bevor er uns informiert, dass er ja seit 36 Jahren mit seiner einzigen Hannelore (eigentlich Ehefrau Nr. drei, aber macht nichts) dahinschwebt, die ihn "Willenlos" mache (und sicher auch froh ist, dass er auf Tournee aufgeräumt ist und nicht daheim durchs Wohnzimmer tigert). Bei der guten alten "Katja (die hat ja)" gibt er dann den Rock'n'Roll-Udo Jürgens, und als er uns dann erzählt, dass er ja vor einiger Zeit beim größten Metal-Festival der Welt auftreten durfte, bringe ich ihn durch geschicktes Gestikulieren sogar dazu, mit mir die Metal-Hörner zu machen - was die Menge natürlich goutiert. Kollege, wenn schon Rock, dann machen wir das auch richtig, gell? Natürlich schließt sich jetzt "Sonne" an, das vom Sound natürlich nicht die Schwere des Originals erreicht, aber seine Stimme bestens inszeniert. Wenn Herr Lindemann mal ausfällt, hier haben wir Ersatz. Die Swing- und dann Rap/Crossover-Fassung der alten "Haselnuss" geht da schon weniger gut ins Ohr, trotz gespielten Dialogs mit der Background-Sängerin in leckerem Lederhöschen, und dann gibt's ein Potpourri der Melodien, die ihn nach eigenen Worten zu dem gemacht haben, was er heute ist, nämlich zu "unserem Heino". Der Gassenhauer, in dem nach mir stets unerfindlichen Gründen die "Sierra Madre" geschlossen hat, wirkt viel verdaulicher als von den unsäglichen Schürzenkaspern, bevor er uns launig erzählt: "Dieses Lied stammt aus einer Zeit, als Sie alle noch nicht da waren. Ich habe es 1954 im Radio gehört, es kam aus Amerika, und ich wollte es schon immer singen." Ok, wir waren zwar vorhin noch per Du, aber richtig: als Dean Martin das Original von "Schön war die Zeit" schmetterte, da hatten wir alle noch keine Probleme mit WLan und Touchscreens. Dann schießt er uns noch das vollkommen abgenudelte Sportfreunde Stiller-Liedchen von der Chillout-Area um die Ohren, dann wandert er nach 60 Minuten erst einmal ab.
Nach einer durchaus ausgedehnten Instrumental-Session - meine Lieben, der Mann geht auf die 80, der braucht mal Pause! - kehrt er aber wieder und serviert uns in massiv glitzerigem Anzug die aktualisierte Version des alten Nena-Reißers vom Leuchtturm, den die ganze Meute begeistert mitgeht. Dann wieder Abgang, und zurück mit seiner Kluft, in der wir ihn eigentlich kennen, dem berühmten roten Jackett, in dem er immer bei Dieter Thomas Heck aufspielte. Für die letzten paar Stücke geht er dann in den Original-Modus, Nummern wie "Caramba Caracho", "Komm in meinen Wigwam" oder auch nochmal den "Enzian" gibt es jetzt wie früher, aber die Menge ist so enthusiasmiert, dass das auch runterläuft. "Alles nur geklaut", "Hoch auf dem gelben Wagen" und dann nochmal "Ein Kompliment" von den Sportskameraden - und aus. Was sagt man dazu? Das ist alles andere als nur ein Gag, eine Selbstparodie oder was auch immer. Das macht Freude, da ist einer, der klug erkannt hat, wie er seine positive und negative Bekanntheit ausschöpft und daraus etwas macht. Und wenn das so gekonnt abgeliefert wird, dann sind wir gerne dabei. Auch wenn er "Jenseits des Tales" nicht gespielt hat.